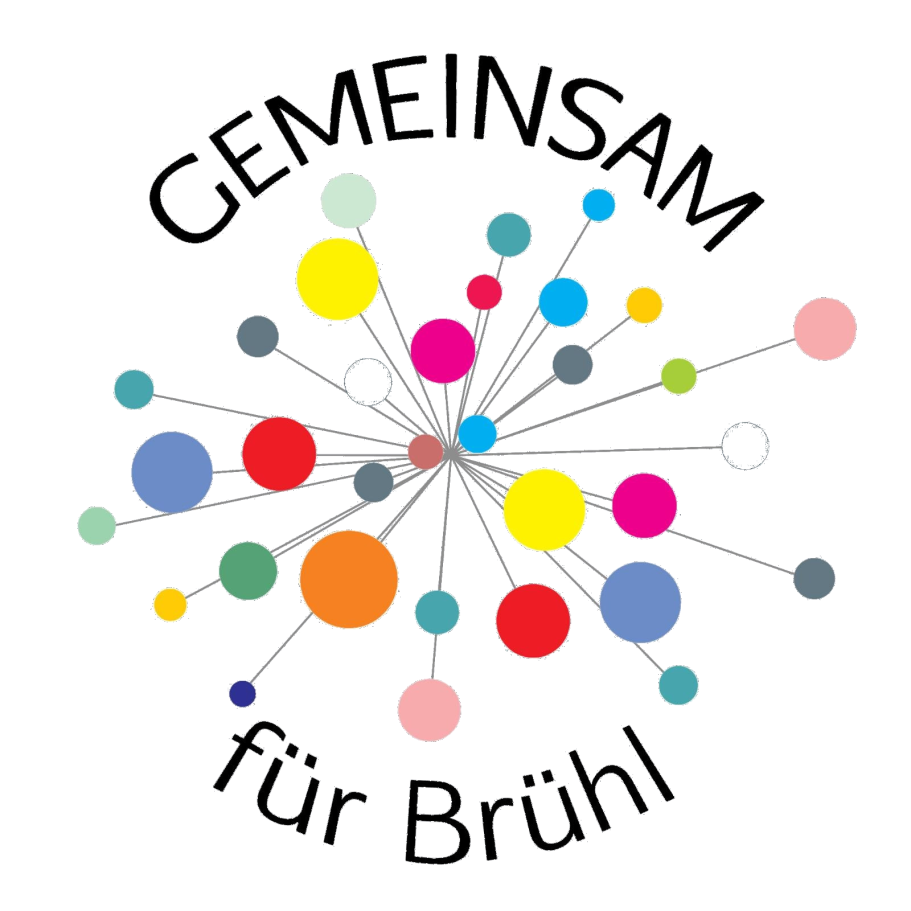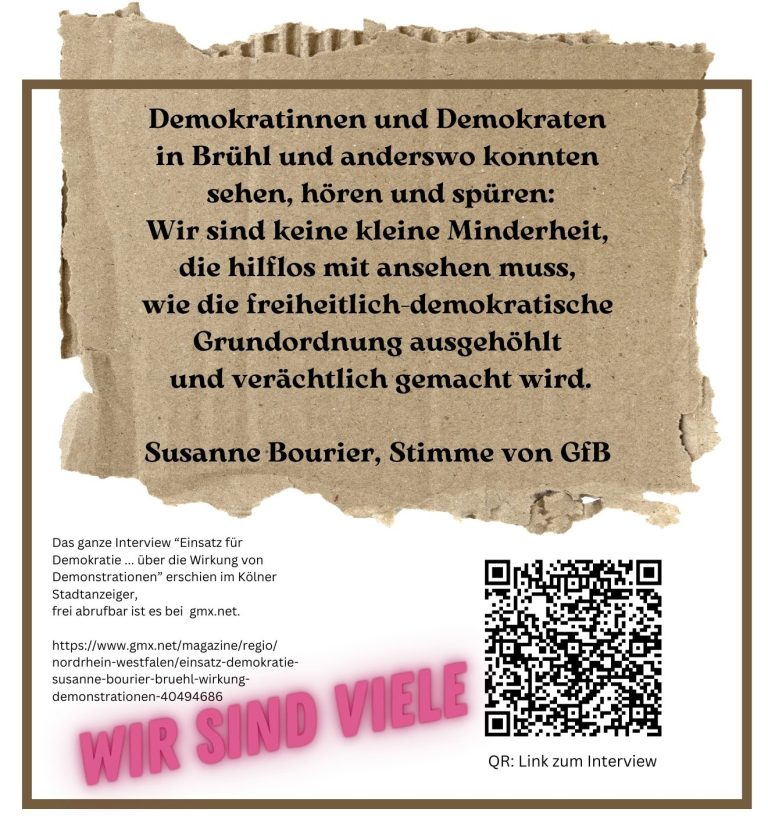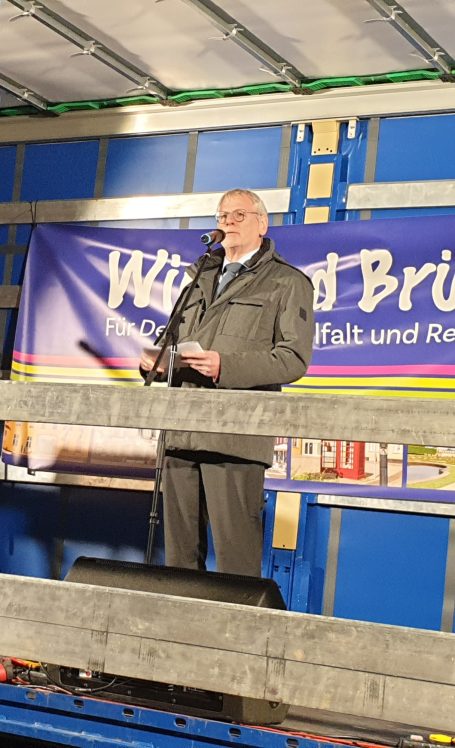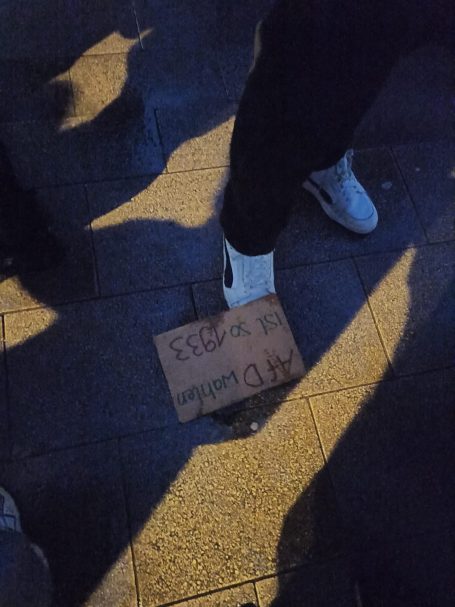Artikelübersicht
Soziologe Aladin El-Mafaalani über Kinder & den Rechtsruck - Jung & Naiv
Interview-Highlights: Aladin El‑Mafaalani im Gespräch bei Jung und Naiv
Zu Gast ist Aladin El‑Mafaalani, renommierter Soziologe, Hochschullehrer und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Seit 2024 ist er Professor für Migrations‑ und Bildungssoziologie an der TU Dortmund – zuvor lehrte er an der FH Münster und der Universität Osnabrück.
Das Interview bei Jung und Naiv beleuchtet zentrale gesellschaftliche Herausforderungen:
Alternde Gesellschaft
Inhalt: Deutschland hat einen hohen Anteil älterer Menschen (über 40 % der Wahlberechtigten sind 60+), was zu einem starken Sicherheits- und Gegenwartsfokus führt.
Zeitbezug: 14:10–14:30
Dauerhaftes Geburtendefizit
Inhalt: Seit den 1970er‑Jahren (konkret seit 1972) übersteigen die Todesfälle regelmäßig die Geburten – ohne Zuwanderung käme es langfristig zu einem Bevölkerungsrückgang.
Zeitbezug: 28:02–28:14
Verlust erfahrener Arbeitskräfte
Inhalt: Der bevorstehende Renteneintritt der Babyboomer (Beginn ca. 20:07) führt zu einem massiven Abbau an Fachkräften, was Wirtschaft und Sozialsysteme stark belastet.
Zeitbezug: 20:07–20:26
Notwendigkeit von Zuwanderung und erhöhter Erwerbsbeteiligung
Inhalt: Um den Fachkräftemangel zu beheben, müssen Zuwanderung und Maßnahmen zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung – vor allem von Frauen – vorangetrieben werden.
Zeitbezug: 20:26–21:04
Belastung der Sozialsysteme
Inhalt: Die abnehmende Anzahl Erwerbstätiger im Verhältnis zu Rentnern und Pflegebedürftigen führt zu erheblichen Herausforderungen für Renten- und Pflegesysteme.
Zeitbezug: 23:02–24:07
Kurzfristiger Gegenwartsfokus
Inhalt: Die starke Orientierung der älteren Wähler auf aktuelle Probleme verhindert oft eine langfristige Auseinandersetzung mit den strukturellen Folgen des demografischen Wandels.
Zeitbezug: 14:10–15:10
Gegenwartsfokus in der Demokratie (15:17–15:42)
Inhalt: Vor 40 Jahren wurde kaum über Rentenreformen diskutiert – der starke Fokus auf die Gegenwart begünstigt, dass politische Konkurrenten, die sich auf aktuelle Probleme konzentrieren, mehr Aufmerksamkeit erhalten.
Link: 15:17–15:42
Sicherheitsorientierung älterer Wähler (15:49–16:09)
Inhalt: Ältere Wähler (bei der letzten Bundestagswahl bereits 50 % über 50) zeigen einen ausgeprägten Sicherheitsbezug – ohne dass dies automatisch mit extremen Tendenzen verbunden wäre.
Link: 15:49–16:09
Traditionelle Parteien und verfestigte Einstellungen (16:09–17:11)
Inhalt: Neue Parteien haben bei älteren Bevölkerungsgruppen weniger Erfolg, da langjährige, verankerte Einstellungen bestehen; Volksparteien wie CDU und SPD bleiben stark.
Link: 16:09–17:11
Themenagenda und Alterskontrast (17:11–18:09)
Inhalt: Während jüngere Generationen Diversität befürworten, bestimmen die älteren als größte Bevölkerungsgruppe, welche Themen priorisiert werden – jüngere agieren risikobereiter, ältere setzen auf Sicherheit.
Link: 17:11–18:09
Politische Ausrichtung und Sicherheitsdiskurs (18:09–18:46)
Inhalt: Der Wahlkampf wird stark durch sicherheitsorientierte Themen geprägt – eine direkte Folge des Altersprofils der Wählerschaft.
Link: 18:09–18:46
Demografischer Wandel: Beginn der Renteneintritte (18:46–19:46)
Inhalt: Seit der 1958er-Generation (teilweise schon mit 65) beginnen Renteneintritte – bis 2035 gehen laut Stefan Schulz mindestens 7 Mio. Arbeitsplätze verloren.
Link: 18:46–19:46
Notwendigkeit von Migration und erhöhter Erwerbsbeteiligung (19:46–21:04)
Inhalt: Da Kinder erst verzögert in den Arbeitsmarkt eintreten, ist Zuwanderung die logische Alternative – kombiniert mit einer Steigerung der Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei Müttern.
Link: 19:46–21:04
Quantitative Herausforderungen im Arbeitsmarkt (21:04–21:58)
Inhalt: Fast 15 Mio. Menschen (nicht alle in Vollzeit) gehen aus dem Arbeitsleben aus. Modelle schätzen einen zusätzlichen Bedarf von netto ca. 400.000, mit Effekten sogar bis über 1 Mio.
Link: 21:04–21:58
Herausforderungen bei Nachwuchskräften (31:01–31:21)
Inhalt: Es wird hinterfragt, ob Modelle die Verzögerungen bei der Qualifizierung junger Menschen und der Integration von Migranten (z. B. durch niedrige Müttererwerbsquoten) ausreichend berücksichtigen.
Link: 31:01–31:21
Geschlechterdisparität bei der Arbeitsmarktintegration (32:00–32:19)
Inhalt: Bei den 2015 Zugekommen liegt die Integrationsquote bei Männern bei ca. 70–80 %, bei Frauen jedoch nur bei ca. 25 % – Gründe sind v.a. Engpässe in der Kinderbetreuung.
Link: 32:00–32:19
Engpässe bei Kinderbetreuung und Kursangeboten (32:27–33:12)
Inhalt: Viele Mütter erhalten keinen Kitaplatz, und fehlende Sprach-/Integrationskurse verzögern die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.
Link: 32:27–33:12
Komplexität des Demografieproblems (33:25–34:16)
Inhalt: Das Demografieproblem wird als tickende Zeitbombe beschrieben, dessen Lösung extrem komplex ist – Lösungsansätze zur Verbindung von Altern und Kindheit lassen sich kaum zu einem Gesamtbild zusammenführen.
Link: 33:25–34:16
Schwierige Renten- und Versorgungspolitik (34:27–35:17)
Inhalt: Eine einfache Erhöhung des Renteneintrittsalters reicht nicht aus; alternativ müssten Senioren mehr Verantwortung übernehmen oder ein neues Rentensystem entwickelt werden – erschwert durch den baldigen Renteneintritt des 1964er Jahrgangs.
Link: 34:27–35:17
Armutsrisiko und strukturelle Probleme (35:05–36:07)
Inhalt: Fast 4 Mio. Rentner leben in Armut – auch wenn das Risiko pro Kopf niedriger ist als bei Kindern, führen die schieren Zahlen zu gravierenden gesellschaftlichen Problemen.
Link: 35:05–36:07
Widersprüchliche Interessen und Versorgungslücken (36:07–37:48)
Inhalt: Die Vorstellung, von einer „Kinder-Minderheit ohne Schutz“ auf eine „Rentner-Mehrheit mit Schutz“ zu schließen, wird kritisch diskutiert – insbesondere, weil die Versorgung älterer Menschen zunehmend schwierig wird und politische Maßnahmen oft nur symbolisch bleiben.
Link: 36:07–37:48
Unzureichende Ausbauoptionen im Gesundheits- und Pflegebereich (37:48–39:02)
Inhalt: Ein massiver Ausbau von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Ärzten und Pflegern wäre notwendig, um den Bedarf zu decken – finanziell und organisatorisch aber kaum realisierbar.
Link: 37:48–39:02
Differenzierung zwischen Renten- und Pflegeproblemen (39:02–39:51)
Inhalt: Während im Rentensystem nahezu alle Rentner ab 65 ihre Leistungen beziehen, ist die Pflege stufenweise und oft unzureichend finanziert – was zu einem akuten Mangel an Pflegeplätzen führt.
Link: 39:02–39:51
Überzogene Staatsausgaben und Zukunftsängste (39:51–40:39)
Inhalt: Prognosen deuten darauf hin, dass künftig ein großer Teil des Bundeshaushalts (rund die Hälfte) aus Rentenzuschüssen und Militärausgaben bestehen könnte – ein Szenario, das als absurd und zukunftsgefährdend angesehen wird.
Link: 39:51–40:39
Konzept „Aktienrente“ als scherzhafte Alternative (40:39–41:03)
Inhalt: Als theoretischer Ansatz wird die „Aktienrente“ erwähnt, bei der Rentner über Investitionen (z. B. in der Rüstungsindustrie) versorgt würden – ein Konzept, das aber für die betroffene Generation unpassend erscheint.
Link: 40:39–41:03
Grenzen innovativer Rentenmodelle (41:03–41:59)
Inhalt: Innovative Ansätze wie die „Aktienrente“ sind für die bevorstehende Rentenwelle nicht praktikabel, da viele der Betroffenen kurz vor dem Renteneintritt stehen.
Link: 41:03–41:59
Nebenbemerkung zu Sponsoring im Sport (41:59–43:07)
Inhalt: Eine humorvolle Kritik an einem Sponsoring-Deal im Fußball (Reinmetall als strategischer Partner), der als unpassend und unklug bewertet wird.
Link: 41:59–43:07
Diskussion zur Einwanderungsgesellschaft (43:07–44:12)
Inhalt: Trotz häufiger Kritik wird betont, dass Deutschland auf Zuwanderung angewiesen ist, um Fachkräfte – vor allem im Pflegebereich – zu gewinnen.
Link: 43:07–44:12
Strukturelle Hindernisse für Zuwanderung (44:12–44:47)
Inhalt: Es werden strukturelle Nachteile wie strenge Sprachvorgaben, ungünstige klimatische Bedingungen und hohe Steuerlasten als Hemmnisse für die Gewinnung von Fachkräften benannt.
Link: 44:12–44:47
Erfahrungsberichte aus dem Gesundheitssektor (44:47–46:09)
Inhalt: Beispiele aus deutschen Krankenhäusern zeigen, dass aus Südamerika stammende Fachkräfte zwar mit hohen Bruttolöhnen angelockt werden, aber aufgrund niedriger Nettolöhne meist nicht lange bleiben – ein Zeichen struktureller Probleme im Arbeitsmarkt.
Link: 44:47–46:09
Lösungsansätze bei sprachlichen und steuerlichen Herausforderungen (46:14–47:02)
Inhalt: Es wird argumentiert, dass hohe Anforderungen an perfektes Deutsch sowie hohe Steuer- und Abgabenlast prinzipiell lösbar sind – etwa durch eine stärkere Akzeptanz von Englisch als Zweitsprache, ohne dabei die Bedürfnisse älterer Menschen in Pflegeeinrichtungen zu vernachlässigen.
Link: 46:14–47:02
Entwicklungen in der Pflege und Relevanz der Einwanderungsdebatte (47:02–49:05)
Inhalt: Die Löhne in der Altenpflege sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen – was Fortschritte zeigt und den Begriff „Einwanderungsgesellschaft“ in diesem Bereich relativiert.
Link: 47:02–49:05
Kriminalitätswahrnehmung und statistische Entwicklungen (49:05–56:03)
Inhalt: Historisch liegt die Zahl schwerer Straftaten (z. B. Mord, Totschlag) sehr niedrig – leichte Zunahmen bei bestimmten Delikten sind im Kontext verbesserter Polizeiarbeit und höherer Sensibilität zu sehen.
Link: 49:05–56:03
Wahrnehmung versus Realität bei Kindesmissbrauch (56:03–57:04)
Inhalt: Obwohl durch Medienberichte der Eindruck eines Anstiegs entsteht, waren in früheren Jahrzehnten vergleichbare Fälle oft weniger aufgearbeitet – eine höhere Wahrnehmung muss nicht gleich ein höheres Risiko bedeuten.
Link: 56:03–57:04
Ursachen des Rechtsrucks und gesellschaftliche Herausforderungen (57:04–1:00:13)
Inhalt: Neben rassistischen Einstellungen spielen ökonomische Faktoren (Angst vor Altersarmut, steigende Mieten, stagnierende Reallöhne, wachsende Ungleichheit) sowie der Rückzug staatlicher Aufgaben eine zentrale Rolle.
Link: 57:04–1:00:13
Ökonomische Unsicherheiten und bröckelnde Solidarität (1:00:13–1:02:33)
Inhalt: Menschen fühlen sich ökonomisch immer stärker an den Rand gedrängt, während ehemals starke solidarische Netzwerke (z. B. in Arbeitermilieus) weitgehend zusammenbrechen – was das Vertrauen in den Sozialstaat untergräbt.
Link: 1:00:13–1:02:33
Wandel der Geschlechterrollen und kulturelle Vielfalt (1:02:44–1:03:15)
Inhalt: Es wird festgestellt, dass sich die Rollen und Einstellungen von Männern und Frauen in jüngeren Generationen auseinanderentwickeln – auch durch die vielfältigen kulturellen Einflüsse der Migration.
Link: 1:02:44–1:03:15
Sprache und gesellschaftlicher Wandel (1:03:15–1:04:12)
Inhalt: Der sprachliche Wandel – etwa das Gendern – wird als Ausdruck kultureller Transformation verstanden; zu starre Eingriffe in den Sprachfluss werden als hinderlich empfunden.
Link: 1:03:15–1:04:12
Zukunftsängste und ökonomische Perspektiven (1:04:12–1:05:03)
Inhalt: Die Aussicht auf eine unsichere Zukunft in einer alternden, global polarisierten Welt mit Klimawandel führt zu einem pessimistischen Zukunftsbild, während die politischen Akteure meist den Status quo beibehalten.
Link: 1:04:12–1:05:03
Konflikte als Zeichen gesellschaftlicher Öffnung (1:05:03–1:06:05)
Inhalt: Konflikte, auch im sprachlichen Bereich, werden als Zeichen für gesellschaftlichen Fortschritt gesehen – sie zeigen, dass unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und eine offene Debattenkultur entsteht.
Link: 1:05:03–1:06:05
Umgang mit Konflikten und digitale Kommunikationsmedien (1:06:05–1:08:26)
Inhalt: Es wird diskutiert, wie Konflikte konstruktiv ausgetragen werden können – digitale Medien fördern aber auch destruktive Dynamiken, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigen können.
Link: 1:06:05–1:08:26
Politische Akteure und Sprache im Wahlkampf (1:08:26–1:10:13)
Inhalt: Anhand des Beispiels Friedrich Merz wird gezeigt, wie spontane, teils provokante Sprachwendungen im Wahlkampf eingesetzt werden – was überraschend und wenig strategisch wirkt.
Link: 1:08:26–1:10:13
Gesetzesänderungen und politischer Kontext (1:10:13–1:12:17)
Inhalt: Neben dem Sprachgebrauch von Merz werden aktuelle Gesetzesänderungen (z. B. zum Staatsangehörigkeitsrecht und zur Fachkräftezuwanderung) thematisiert – häufig überschattet von impulsiven Äußerungen.
Link: 1:10:13–1:12:17
Eindruck und Wirkung im politischen Diskurs (1:12:17–1:13:03)
Inhalt: Es wird die Frage erörtert, ob provokante Redestile wie die von Merz das öffentliche Bild nachhaltig verändern – ein Zeichen für mangelnden strategischen Weitblick.
Link: 1:12:17–1:13:03
Vertrauenswürdigkeit und Erwartungen an Spitzenpolitiker (1:13:03–1:13:35)
Inhalt: Entscheidend ist nicht, wer Kanzler wird, sondern dass die Person vertrauenswürdig, maßvoll und verlässlich agiert – persönliche Eigenschaften stehen hier im Vordergrund.
Link: 1:13:03–1:13:35
Kritik und neue Begriffe im politischen Diskurs (1:13:35–1:15:18)
Inhalt: Abschließend wird angemerkt, dass bei zu lobenden Worten über Politiker wie Friedrich Merz Widerstände entstehen können – ein Begriff wie „sauerländischer Trumpismus“ (geprägt von Karl Rudolf Korte) fasst die Kritik an der aktuellen politischen Landschaft zusammen.
Link: 1:13:35–1:15:18
Das Interview geht insgesamt über 4 Stunden, die Verlinkung von dieser Seite aus geht nur bis 1:15 h.
Menschenkette gegen Rechts in Brühl (Danke, Omas!)
08.02.25
700 Menschen setzen ein starkes Zeichen für Demokratie! Heute war Brühl laut und deutlich: Rund 700 Menschen haben gemeinsam für Demokratie, Toleranz und Vielfalt demonstriert. Die von den Brühler Omas gegen Rechts organisierte Menschenkette war ein starkes Zeichen gegen Hass und Spaltung. Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden und an Gemeinsam für Brühl für die tatkräftige Unterstützung! Die große Beteiligung zeigt: Wir stehen zusammen für eine offene Gesellschaft. Jetzt gilt es, dran zu bleiben: Engagiere dich, informiere dich, widerspreche, wenn Lügen und Hetze verbreitet werden. Demokratie braucht deine Stimme – auch über diesen Tag hinaus! ❤️✊
Vortrag Christian Stöcker: Warum selbst gute Klimanachrichten kaum gehört werden
Zusammenfassung und Einstiegspunkte
Hier findest du das Video von Christian Stöcker, SPIEGEL-Bestseller-Autor von „Männer, die die Welt verbrennen“, der beim Super Impact Day – dem Klima-Event für mutige Stadtwerke, Städte und Kommunen – am 29. Januar 2025 in Lübeck live dabei war. In seiner Keynote enthüllt Christian die 6 größten Mythen rund um Klima und Energiewende. Er zeigt auf, wie fossile Brennstoffe durch massive Subventionen gestützt werden, warum die Ölindustrie Milliarden in Lobbyarbeit steckt und beleuchtet das beeindruckende, rasante Wachstum erneuerbarer Energien – mit einem besonderen Blick auf Deutschlands unterschätzte Rolle im Solar-Boom. Außerdem erfährst du, warum das enorme Potenzial von Solarenergie, Elektroautos und Batteriespeichern oft übersehen wird.
Link zum Video
https://www.youtube.com/watch?v=DCuz9vv7nQI
Enorme Profite und Subventionen der fossilen Industrie
Die Öl‑ und Gasbranche erzielt jährlich Gewinne im Billionen-Dollar-Bereich (tatsächlich etwa 1–2 Billionen Dollar) – weit mehr als ihr Umsatzanteil vermuten lässt.
Gleichzeitig fließen massiv hohe Subventionen (im Jahr 2022 ca. 1,3 Billionen Dollar explizit, plus zusätzliche implizite Förderungen) in diese Branche.
Zum Thema Profite & Subventionen (ca. 5:20–5:42)
Eindeutige Belege für den menschengemachten Klimawandel
Aktuelle Messwerte (z. B. 426 ppm CO₂) und die Zunahme extremer Wetterereignisse (wie Unwetter und Überschwemmungen) machen die Realität des Klimawandels deutlich.
Zum Thema Klimawandel (ca. 2:18)
Entlarvung von Mythen und Desinformation
Es kursieren weit verbreitete Falschinformationen, etwa dass Bevölkerungswachstum in Afrika für die Klimakrise verantwortlich sei – tatsächlich liegen 81 % der CO₂-Emissionen in den Industrieländern.
Zum Mythos „Afrika ist schuld“ (ca. 3:42)
Die doppelte Wirkung von Regulierung
Einerseits wurden mit politischen Maßnahmen wie dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz enorme Märkte in Bewegung gesetzt und die Transformation beschleunigt.
Andererseits können Regulierungen (zum Beispiel in Deutschland) auch zu einem Verlust von Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren Technologien führen, wenn sie nicht optimal gestaltet sind.
Zum Thema Regulierung und deren Effekte (ca. 10:06)
Exponentielles Wachstum erneuerbarer Energien
Der Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Neuausbau liegt 2023 bei etwa 86 %, was den rasanten, exponentiellen Wandel im Energiesystem unterstreicht.
Viele unterschätzen, wie stark exponentielles Wachstum – etwa bei Photovoltaik, Windkraft oder Batteriespeichern – die Energiemärkte transformiert.
Zum Thema exponentielles Wachstum (ca. 12:06)
Exponential statt linear – falsche Annahmen
Der Sprecher kritisiert, dass viele Fachleute exponentielles Wachstum (bei Photovoltaik, Elektromobilität, Batteriespeichern) fälschlicherweise als lineares Wachstum deuten. Dabei können exponentielle Prozesse plötzlich zu qualitativ anderen Entwicklungen führen.
Zum Thema exponentielles Wachstum (ca. 21:15)
Rasanter Aufstieg erneuerbarer Energien
Die Wachstumskurven von Photovoltaik (linke Kurve) und Windenergie (grüne Kurve) übertreffen deutlich die traditionellen Energiequellen (Atom, Gas, Kohle, Wasserkraft). Noch nie hat sich eine Energieversorgungsmethode so schnell entwickelt wie die Erneuerbaren – getrieben durch drastisch fallende Preise.
Zum Vergleich der Wachstumskurven (ca. 22:21)
Preisverfall und Investitionsdruck
Sinkende Kosten bei Technologien wie Wind, Offshore-Solar und Batterien machen erneuerbare Energien zunehmend günstiger als fossile Brennstoffe. Dieser Kostendruck führt dazu, dass Investoren verstärkt in erneuerbare Systeme investieren – auch wenn politische Akteure wie Donald Trump versuchen, mit regulatorischen Maßnahmen gegenzusteuern.
Zum Thema Preisdruck (ca. 23:00)
Globale Transformation zur dezentralen Energieversorgung
Besonders im Globalen Süden – etwa in Pakistan – wird der Wandel sichtbar: Aufgrund teurer und unzuverlässiger, kohlebetriebener Stromnetze setzen immer mehr Menschen auf dezentrale Lösungen wie Photovoltaik auf dem Dach und Batteriespeicher, um ihre eigene Energieversorgung zu sichern.
Zum Beispiel Pakistan (ca. 25:09)
Wachsende private Investitionen und Rückgang öffentlicher Netze
In Ländern wie Pakistan baut die private Nutzung von Solaranlagen rasant aus – so sehr, dass zum ersten Mal die Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz zurückgeht. Dieser Trend spiegelt sich weltweit wider und wird von Investitionen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und moderne Stromnetze (im Gesamtwert von Billionen Dollar) unterstützt.
Zum Trend privater Investitionen (ca. 29:00)
Desinformation in der öffentlichen Debatte
Der Beitrag zeigt, wie in Talkshows und Medien fiktive Technologien – etwa der angebliche Einsatz von Solarpanelen zur Wasserstoffproduktion, um weiter Gas zu nutzen – propagiert werden. Diese irreführenden Ansätze dienen dazu, den Einbau wirklich effektiver Technologien wie Wärmepumpen zu verhindern.
Zum Thema Desinformation (ca. 31:04)
Kritik an der vermeintlichen „Renaissance“ der Atomkraft
Die sogenannte Rückkehr zur Atomkraft entpuppt sich als Unsinn: Projekte wie Hinkley Point C in Großbritannien sind massiv überteuert und verzögern sich stark. Während solche Vorhaben kaum wirtschaftlich sind, fließt das Kapital zunehmend in erneuerbare Technologien und Batteriespeicher.
Zum Thema Atomkraft (ca. 35:26)
Wirtschaftliche Realität vs. politische Rhetorik
Trotz politischer Desinformationskampagnen und Versprechungen von Akteuren, die den Status quo verteidigen wollen, zeigen die aktuellen Investitionstrends eindeutig: Der Markt verschiebt sich unwiderruflich hin zu dezentralen, nachhaltigen und kostengünstigen Energiesystemen.
Zum Abschluss der Argumentation (ca. 36:46)
Investitionen: Atomkraft versus Batteriespeicher
Die Medien betonen oft den „Boom“ der Atomkraft (rote Säulen), obwohl die tatsächlichen Investitionen in Batteriespeicher (blaue Linie) weitaus höher sind. China zeigt, dass es mehr erneuerbare Kapazitäten installiert als der Rest der Welt zusammen – eine echte Renaissance der Atomkraft gibt es so nicht.
Zum Thema Investitionen (ca. 37:23)
Mythen um Elektromobilität und Batterietechnologie
Fälschliche Behauptungen, Elektroautos seien unsicher (z. B. wegen angeblich erhöhtem Brandrisiko bei falscher Reifenmontage) und Batterien seien schlecht recycelbar, werden entkräftet. Tatsächlich brennen Verbrenner häufiger und Batterien sind zu etwa 90 % recyclebar.
Zum Thema Elektromobilität und Recycling (ca. 38:41)
Marktentwicklung: Boom der Elektromobilität
Der vermeintliche Einbruch im Markt für Elektroautos ist ein Desinformationsnarrativ – im Gegenteil, globale Verkaufszahlen zeigen einen klaren, exponentiellen Boom, während der Marktanteil von Verbrennern seit 2017 kontinuierlich sinkt.
Zum Thema Marktentwicklung (ca. 40:42)
Verzerrte öffentliche Wahrnehmung der Energiewende
Es kursieren Desinformation und Mythen, die den Eindruck erwecken, die Energiewende würde scheitern. Dabei treibt vor allem die private, dezentrale Transformation – etwa durch Photovoltaik, Wärmepumpen und Batteriespeicher in Einfamilienhäusern, häufig in ländlichen Regionen – den Wandel voran.
Zum Thema Energiewende (ca. 42:06)
Netzwerke der Desinformation und ihr Einfluss
Der Beitrag zeigt, wie Think Tanks und Netzwerke (z. B. das Atlas-Netzwerk) sowie prominente Akteure wie Frank Scheffler systematisch Desinformation verbreiten, um den Fortschritt der Energiewende zu blockieren und fossile Interessen zu schützen.
Zum Thema Desinformationsnetzwerke (ca. 43:04)
Strategien im Umgang mit Desinformation
Christian betont, dass es oft sinnlos ist, mit Klimawandelleugnern zu diskutieren. Stattdessen sollte man deren Reichweite durch Blockieren in den sozialen Medien begrenzen und in Formaten wie Talkshows auf Live-Fact-Checks setzen, um falsche Aussagen direkt zu widerlegen.
Zum Thema Umgang mit Desinformation (ca. 51:01)
Handlungsempfehlungen und politischer Appell
Abschließend wird betont, dass die Transformation des Energiesystems unausweichlich und bereits in vollem Gange ist. Politisch und gesellschaftlich steht die Wahl – wollen wir auf der wirtschaftlich und zukunftsorientiert sinnvollen Seite stehen? Wer die richtigen Weichen stellt, kann nicht nur national, sondern auch global Impulse setzen.
Zum Appell an Politik und Gesellschaft (ca. 57:58)

Hörtipp: Mythen über Migration: Viele Annahmen stimmen nicht
Migration – kaum ein Thema wird derzeit so hitzig diskutiert. Doch was, wenn vieles, was wir darüber zu wissen glauben, gar nicht stimmt? Der Migrationsforscher Hein de Haas räumt in seinem Vortrag mit gängigen Mythen auf – und du kannst dabei sein!
Eine der spannendsten Erkenntnisse: Armut ist selten der Hauptgrund für Migration. Im Gegenteil: Erst wenn Menschen ein gewisses Bildungs- und Einkommensniveau erreichen, haben sie überhaupt die Mittel und Möglichkeiten auszuwandern. Migration ist also kein Zeichen von Scheitern, sondern von Entwicklung.
Zudem zeigt Hein de Haas, dass Migration vor allem durch Arbeitskräftemangel im Westen getrieben wird – nicht durch politische Entscheidungen oder Grenzkontrollen. Paradoxerweise können strikte Einwanderungsgesetze sogar dazu führen, dass mehr Menschen bleiben, weil sie nicht mehr so einfach pendeln können.
Willst du mehr wissen? Dann hör dir diesen aufschlussreichen Vortrag an! Hein de Haas bringt Licht ins Dunkel der Migrationsdebatte – fundiert, überraschend und absolut hörenswert. 🎧
Website: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/migration-viele-gaengige-annahmen-stimmen-nicht
mp3: https://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2025/01/30/deutschlandfunknova_mythen_ueber_migration_20250130_09f5fa83.mp3
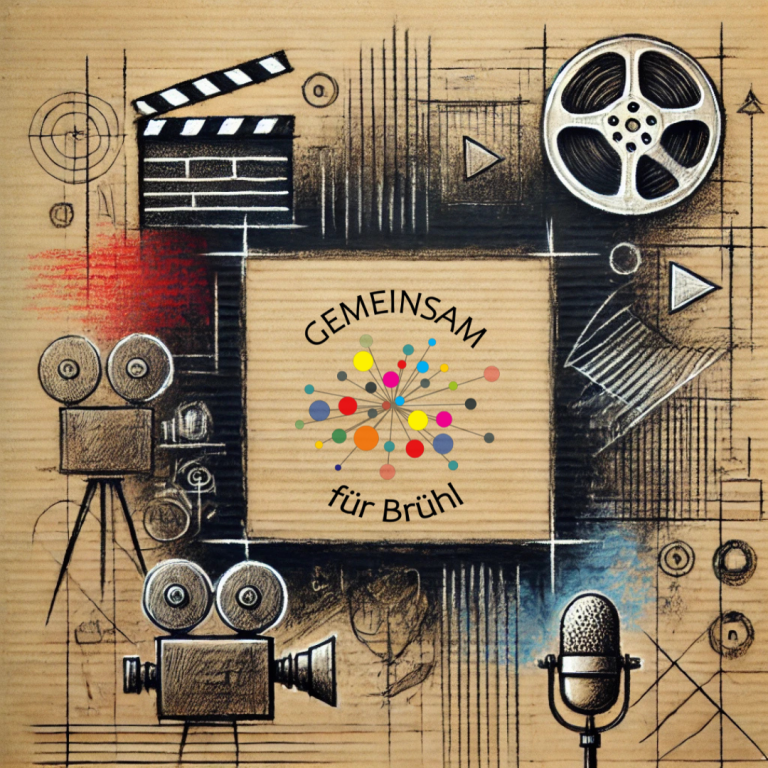
Youtube-Kanal kommt
Am 16.01.25 startet unser YouTube-Kanal
@GemeinsamFuerBruehl!
🎥 Mit Clips zu unseren Themen, beginnend mit einem Video gegen Rassismus.
Gemeinsam für Solidarität und Vielfalt! 🌍💪
Abonniert uns
https://www.youtube.com/@GemeinsamFuerBruehl
Auf dem Kanal werden wir kurze Clips zu den Kernthemen unserer Initiative veröffentlichen.
Unser erstes Video, "Fremdschämen auf der Römerstaße", setzt sich mit dem Thema Rassismus auseinander.
Es handelt von einer Geschichte, die sich wirklich so in Brühl zugetragen hat.
Link zum Video
"Fremdschämen auf der Römerstaße" (2 min)
Sieben Gegenstrategien gegen (Rechts-)Populismus
Die sieben Gegenstrategien gegen (Rechts-)Populismus aus dem Leitfaden von der Webseite "Forum Streitkultur" lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Klarheit in der Kommunikation: Rechtspopulistische Aussagen sollten mit präzisen, gut belegbaren Argumenten entkräftet werden. Vermeide Übertreibungen und bleib sachlich.
Verständliche Sprache: Komplexe Themen in einfacher und direkter Sprache darstellen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.
Emotionen gezielt einsetzen: Emotionale Ansprachen sollten konstruktiv und aufbauend sein, um positive Werte wie Gemeinschaft und Demokratie zu betonen.
Narrative verändern: Statt populistischer Angst- und Bedrohungsszenarien alternative, positive Zukunftsvisionen anbieten.
Gezielte Beispiele nutzen: Abstrakte Aussagen mit konkreten, alltagsnahen Beispielen veranschaulichen.
Thematische Fokussierung: Nicht auf Themenwechsel oder Ablenkungsversuche der Populisten eingehen. Beim Thema bleiben.
Haltung zeigen: Eine klare Position für Demokratie und Vielfalt beziehen, um Vertrauen aufzubauen und Orientierung zu bieten.
Diese Strategien sollen helfen, rechtspopulistischen Tendenzen effektiv entgegenzutreten, dabei sachlich zu bleiben und eine demokratische Debatte zu fördern.
Link zur ausführlichen Darstellung und Quelle
https://forum-streitkultur.de/sieben-gegenstrategien/
Tu was! - Einmischen! - Ruprecht Polenz im Interview
Ruprecht Polenz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Experte für Außenpolitik, setzt sich mit Nachdruck für Demokratie, Vielfalt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. In seinem Buch "Tu was! Kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie" und in Interviews erläutert er, wie wichtig es ist, aktiv zu werden, um die Demokratie zu stärken.
Hier wird er im Podcast "Einmischen! Politik Podcast" interviewt (63 min):
@einmischenpodcast
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xnfMPlHoM
Begrüßung und Einführung (0:00 - 1:00)
Vorstellung des Podcasts, Gastankündigung und Hinweise zur Unterstützung.
Vorstellung von Ruprecht Polenz (1:00 - 2:00)
Überblick über Polenz’ politische Laufbahn und sein Buch "Tu was!".
Was ist Demokratie? (2:00 - 3:40)
Definition von Demokratie mit Fokus auf Gewaltenteilung und Kontrolle der Macht.
Gewaltenteilung in Deutschland (3:40 - 4:30)
Beschreibung der Organisation der Gewaltenteilung in Bund, Ländern und Kommunen.
Migration und Populismus (4:30 - 5:30)
Diskussion über aktuelle politische Debatten, populistische Narrative und strukturelle Probleme.
Terrorismus als Bedrohung der Demokratie (5:30 - 7:00)
Analyse der Ziele von Terrorismus: Spaltung und Destabilisierung der Gesellschaft.
Mechanismen des Terrors (7:00 - 8:00)
Beispiel Bataclan-Anschlag und die Rolle von Übergriffen als Provokation zur Gewaltspirale.
Antwort auf Terrorismus (8:00 - 9:00)
Notwendigkeit von Zusammenhalt, Ruhe und entschlossenem Handeln in Krisen.
Demonstrationen für Demokratie (9:00 - 9:40)
Positives Beispiel aus Ostdeutschland: Demonstrationen gegen rechtsextreme Tendenzen.
Kritik an populistischen Reaktionen (9:40 - 10:00)
Wie rechtspopulistische Akteure Terroranschläge für ihre Spaltungsagenda nutzen.
Populistische Panikmache (10:00 - 10:45)
Kritik an der Polemik und Polarisierung durch politische Akteure in Krisensituationen.
Grenzen des Populismus (10:45 - 12:00)
Diskussion über problematische Vorschläge, wie das generelle Ausschließen bestimmter Flüchtlingsgruppen, und deren rechtliche Unvereinbarkeit.
Gemeinsame Lösungen finden (12:00 - 12:50)
Notwendigkeit der Zusammenarbeit demokratischer Parteien, um realistische und umsetzbare Lösungen für Migration und Flüchtlingspolitik zu entwickeln.
Grenzkontrollen: Wo und wie? (12:50 - 14:00)
Argumente für die Kontrolle an EU-Außengrenzen statt nationalen Grenzen, um die europäische Freizügigkeit zu bewahren.
Praktische Herausforderungen bei Abschiebungen (14:00 - 15:45)
Politische und juristische Hürden bei Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, einschließlich moralischer und praktischer Überlegungen.
Populismus in der politischen Debatte (15:45 - 17:00)
Kritik am populistischen Umgang mit Migrationsthemen auch innerhalb demokratischer Parteien.
Treue zu demokratischen Werten (17:00 - 18:00)
Die Bedeutung, auch in schwierigen Zeiten an demokratischen Prinzipien festzuhalten.
Langwierigkeit demokratischer Prozesse (18:00 - 18:45)
Erklärung, warum Lösungen in Demokratien oft Zeit brauchen, und warum das trotzdem wichtig ist.
Alarmsignale für die Demokratie (18:45 - 19:30)
Niedriges Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Parteien und die Gefahr von Verschwörungstheorien.
Verständnis für Demokratie stärken (19:30 - 20:00)
Vergleich von Demokratie mit einer erlernten Fähigkeit wie Schwimmen: Praxis ist essenziell, um Demokratie zu verstehen und zu bewahren.
Demokratie lernen und praktizieren (20:00 - 21:10)
Die Bedeutung praktischer Demokratieerfahrungen in Schulen, wie Mitbestimmung und Debatten, um politisches Verständnis zu fördern.
Gefährdungen der Demokratie (21:10 - 22:00)
Populismus als Bedrohung für demokratische Parteien und Werte, wenn sie rechte Strategien übernehmen.
Die Grundlagen der Demokratie (22:00 - 23:10)
Böckenförde-Diktum: Demokratie beruht auf sozialen Voraussetzungen wie Vertrauen und Respekt, die sie selbst nicht schaffen kann.
Demokratie als vorgestellte Ordnung (23:10 - 24:30)
Vertrauen als Fundament der Demokratie: Parallelen zu Geldsystemen und historische Beispiele für Vertrauenserosion.
Strategien der AfD und externe Akteure (24:30 - 25:40)
Wie die AfD und Medien wie Russia Today gezielt das Vertrauen in demokratische Institutionen untergraben.
Die Bedeutung von Vertrauen (25:40 - 27:00)
Warum Vertrauen in Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht essenziell für eine funktionierende Demokratie ist.
Akzeptanz demokratischer Prozesse (27:00 - 28:10)
Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen trotz Meinungsverschiedenheiten als Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt.
Demokratie-Index und globale Perspektive (28:10 - 29:10)
Einordnung Deutschlands unter den weltweit wenigen vollständigen Demokratien und Unterschiede zu unvollständigen Demokratien.
Glück der Demokratie-Lotterie (29:10 - 30:00)
Reflexion über die Vorteile, in einer Demokratie zu leben, im Vergleich zu autoritären oder instabilen Ländern.
Vertrauensverlust in die Medien (30:00 - 31:00)
Diskussion über den schwindenden Glauben der Bürger*innen an die Medien und die daraus resultierenden Probleme.
Meinungsfreiheit und rechtliche Grenzen (31:00 - 33:00)
Die Auslegung der Meinungsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht und Beispiele wie das "Kompakt"-Verbot.
Wehrhafte Demokratie und Propaganda (33:00 - 35:00)
Herausforderungen im Umgang mit Propaganda und das Gleichgewicht zwischen Meinungsfreiheit und Schutz der Demokratie.
Lügenpresse und Orientierungslosigkeit (35:00 - 37:00)
Die Gefahr der Orientierungslosigkeit durch den Glauben an systematische Desinformation und deren politische Konsequenzen.
Populismus und einfache Lösungen (37:00 - 38:00)
Warum Bürger*innen in Krisen zu lauten und grellen Stimmen wie der AfD oder Trump tendieren.
Gefahr der Desinformationsmedien (38:00 - 39:00)
Wie Desinformation und gezielte Medienstrategien Platz für antidemokratische Inhalte schaffen.
Rolle der sozialen Medien (39:00 - 40:00)
Einfluss von Social-Media-Plattformen, Milliardärs-Besitz und die Verbreitung ungeprüfter Informationen, wie im Fall Bangladesch.
Wem sollen wir glauben? (40:00 - 41:00)
Die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Medien und wie sie ihre Inhalte auswählen und einordnen.
Qualitätsjournalismus vs. Social Media (41:00 - 42:30)
Unterschiede zwischen traditionellen Medien und sozialen Netzwerken, inklusive der Herausforderungen ungefilterter Informationen.
Faktenchecks und Trollfabriken (42:30 - 44:00)
Die Rolle von Faktencheck-Portalen und gezielter Desinformation, insbesondere durch internationale Akteure wie Russland.
Strategien gegen Desinformation (44:00 - 46:00)
Praktische Tipps, um sich verlässlicher zu informieren, wie Zeitungsabos und Bibliotheksdienste.
Social Media als Durchlauferhitzer (46:00 - 47:30)
Der Einfluss sozialer Medien auf die öffentliche Meinung und die politische Meinungsbildung.
Stärkung der Demokratie durch Teilen positiver Inhalte (47:30 - 49:00)
Die Bedeutung von Likes und Reposts für die Verbreitung vernünftiger Beiträge in sozialen Medien.
Vorbereitung politischer Debatten durch Social Media (49:00 - 50:00)
Wie Diskussionen in sozialen Medien politische Themen in die allgemeine Öffentlichkeit bringen.
Zivilcourage im Alltag (50:00 - 52:00)
Wie Zivilcourage am Arbeitsplatz und im Alltag das gesellschaftliche Klima verbessern kann.
Dankbarkeit zeigen als politischer Akt (52:00 - 54:00)
Die Bedeutung von Dankbarkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Werte.
Gefährliche Rolle von Ängsten in der Politik (54:00 - 56:00)
Wie populistische Parteien Ängste verstärken und davon profitieren.
Talkshows und Polarisierung (56:00 - 59:00)
Kritik an den Formaten öffentlich-rechtlicher Talkshows und deren Fokus auf Polarisierung.
Langformatige Diskussionen als Alternative (59:00 - 61:00)
Vorteile von ausführlichen Gesprächen und Podcasts für tiefere politische Diskussionen.
Praktisches Engagement für Demokratie (61:00 - 63:17)
Konkrete Beispiele, wie man sich aktiv in der Gemeinschaft engagieren kann, von Elternarbeit bis Tierschutz.
Wichtige Kernbotschaften
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit
Polenz betont, dass Demokratien weltweit selten und verletzlich sind. Nur durch Engagement der Bürger*innen kann ihre Stabilität gewährleistet werden.
Zivilcourage und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Demokratie lebt vom gegenseitigen Respekt und Zusammenhalt. Er fordert dazu auf, im Alltag Zivilcourage zu zeigen – sei es durch das Ansprechen von rassistischen oder populistischen Bemerkungen oder durch kleine Gesten wie Dankbarkeit gegenüber Mitmenschen.
Wehrhafte Demokratie gegen Spaltung
Rechtspopulisten wie die AfD versuchen gezielt, Vertrauen in Institutionen, Medien und den Rechtsstaat zu untergraben. Polenz ruft dazu auf, diese Strategien zu durchschauen und aktiv gegenzusteuern, um die Gesellschaft nicht spalten zu lassen.
Bildung und Engagement fördern
Praktische Demokratieerfahrungen, etwa in Schulen oder durch Engagement in der Nachbarschaft, sind laut Polenz essenziell. Nur wer demokratische Prozesse versteht, kann sie auch verteidigen.
Seine Aufforderung
Jede*r kann etwas beitragen, sei es durch Diskussion, Engagement oder das Teilen und Unterstützen demokratischer Inhalte. Demokratie ist ein "Teamsport" – sie lebt von der Beteiligung aller.
Polenz' Botschaft ist klar: "Warte nicht darauf, dass andere handeln. Tu etwas – für die Demokratie!"
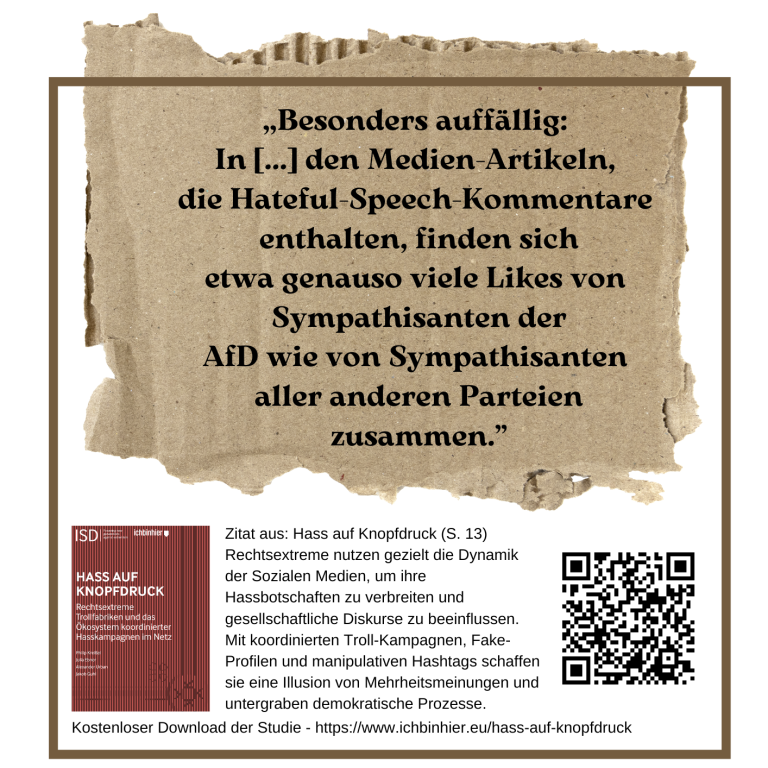
Hass auf Knopfdruck
Die Studie „Hass auf Knopfdruck“ des Londoner Institute for Strategic Dialogue (ISD) und der Initiative ichbinhier e.V. enthüllt die gezielten Strategien rechtsextremer Gruppen, um in Sozialen Netzwerken Hass zu verbreiten und gesellschaftliche Diskurse zu beeinflussen. Mit mehr als 1,6 Millionen analysierten Beiträgen zeigt die Untersuchung, wie koordinierte Kampagnen und Fake-Profile eine scheinbare Mehrheitsmeinung vortäuschen und demokratische Prozesse bedrohen.
Ein besonders perfides Mittel sind orchestrierte Online-Aktionen wie die Debatten um vermeintliche Skandale bei Kinderformaten oder lokale Ereignisse, die gezielt aufgebauscht und instrumentalisiert werden, um gesellschaftliche Spaltung zu fördern. So wurden Hashtags wie #KiKAgate, bei dem ein Kinderfernsehbeitrag für absurde Vorwürfe missbraucht wurde, oder #kandelistüberall, das nach einer Gewalttat zu einer regelrechten Hetzkampagne ausartete, von rechtsextremen Gruppen gezielt mit Hassinhalten gefüllt. Solche Aktionen zielen darauf ab, Ängste zu schüren und Aufmerksamkeit für extremistische Narrative zu erzeugen.
Dabei wird deutlich: Obwohl das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) offensichtliche Hassbotschaften reduziert hat, nehmen diese orchestrierten Kampagnen weiter zu. Die Studie verdeutlicht, wie wichtig Moderation in Kommentarspalten und digitale Zivilcourage sind. Erfahre mehr über die Hintergründe und die Strategien hinter diesen Kampagnen – und wie du selbst aktiv gegen digitalen Hass werden kannst!
Eine kleine, aber organisierte Gruppe von Accounts verbreitet gezielt Hate Speech unter Artikeln großer deutschsprachiger Newsseiten auf Facebook. Diese Aktionen sind inhaltlich und zeitlich koordiniert, oft über Plattformen wie „Discord“ und geschlossene Facebook-Gruppen, die Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen haben. Ziel ist es, extremistische Inhalte als gesellschaftlichen Mainstream erscheinen zu lassen und Meinungen in der Mitte der Gesellschaft zu manipulieren.
Die Strategien beinhalten gezielte Shitstorms, die durch Masse an Kommentaren und Likes eine verzerrte Meinungsdominanz suggerieren. Analysen zeigen, dass 5 % der aktiven Accounts 50 % der Likes für Hasskommentare generieren, was nicht nur Fehlinformationen, sondern auch ein Klima der Straflosigkeit für Hassreden erzeugt. Dies verdrängt pluralistische Diskurse und bedroht Grundwerte wie Meinungsfreiheit und den Schutz von Minderheiten. Der langfristige Schaden für gesellschaftlichen Zusammenhalt und politische Kultur ist schwer abschätzbar.
Die Studie empfiehlt umfassende Maßnahmen, um koordiniertem Hass in sozialen Netzwerken entgegenzuwirken und demokratische Werte zu schützen:
Erkennung und Analyse rechtsextremer Netzwerke: Die Identifizierung und Beobachtung illiberaler Gruppierungen wie der Identitären Bewegung durch Behörden und Zivilgesellschaft muss intensiviert werden.
Aufklärung und Sensibilisierung: Medien und zivilgesellschaftliche Institutionen sollten die Öffentlichkeit über die Mechanismen koordinierter Hasskampagnen informieren und zur Wachsamkeit anregen.
EU-weite Zusammenarbeit: Ähnliche Analysen und Initiativen in anderen EU-Ländern sind nötig, um den gesellschaftlichen Frieden in Europa zu sichern. Counter-Speech-Initiativen wie #ichbinhier verdienen Unterstützung.
Kooperation mit Plattformbetreibern: Soziale Netzwerke müssen Frühwarnsysteme entwickeln, um Hasskampagnen frühzeitig zu erkennen. Der Zugang zu öffentlichen Daten sollte verbessert werden, um NGOs und Aktivisten zu stärken.
Förderung digitaler Zivilcourage: Nutzerinnen und Nutzer sollten Opfer von Shitstorms unterstützen, Hasskampagnen entlarven und respektvoll kommunizieren, um gesellschaftliche Spaltung zu verhindern.
Moderation in Kommentarspalten: Aktive Moderation durch Medien kann die Diskussionskultur verbessern, differenzierte Stimmen stärken und die Nutzung der Plattformen durch extremistische Gruppen verhindern.
Stärkere staatliche Maßnahmen: Verfassungsschutz, Justiz und Strafverfolgungsbehörden sollten soziale Medien stärker in den Fokus nehmen, um demokratische Institutionen zu schützen und gezielte Angriffe rechtsstaatlich zu verfolgen.
Diese Empfehlungen betonen die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, um der Verbreitung von Hass und extremistischen Narrativen wirksam zu begegnen.
Einsatz für Demokratie: Über die Wirkung von Demonstrationen
25.12.24
Ein Weckruf für die Demokratie: Susanne Bourier über die Kraft friedlicher Demonstrationen
Friedliche Demonstrationen, parteiübergreifende Solidarität und ein starkes Signal für Demokratie – das waren die Highlights eines ereignisreichen Jahresbeginns 2024 im Rhein-Erft-Kreis. Susanne Bourier, eine Stimme von der der Initiative „Gemeinsam für Brühl“, zieht in einem Interview ein beeindruckendes Fazit: Der Widerstand gegen Rechtsextremismus lebt, und er eint Menschen, die für demokratische Werte einstehen.
Was als Eindruck nach den Demonstrationen bleibt, ist eine Botschaft der Stärke: Sie haben bewiesen, dass Bürger*innen bereit sind, für ihre Überzeugungen auf die Straße zu gehen – ein deutliches Nein zu menschenverachtenden Ideologien. Gleichzeitig haben sie vielen das Gefühl gegeben, nicht allein im Kampf für Demokratie zu sein. Besonders Brühl stach mit zwei Demonstrationen hervor und zeigte, wie kraftvoll ein überparteiliches Bündnis wirken kann.
Doch die Arbeit ist längst nicht getan. Bourier mahnt an, die demokratischen Kräfte dauerhaft zu vernetzen und auf neue Herausforderungen vorbereitet zu sein. Mit weiteren Aktionen und einem Fokus auf Dialog und Aufklärung wird daran gearbeitet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen.
Ein Appell an uns alle: Demokratie braucht Engagement. Die Demonstrationen mögen vergangen sein, doch die Botschaft bleibt: Gemeinsam sind wir stärker. Dein Einsatz zählt – heute und morgen.
Link zum ganzen Interview
Warum wählen Menschen mit Migrationshintergrund die AfD – und welche gesellschaftlichen Gefahren birgt das?
23.12.24
Die AfD verfolgt das Ziel, sich von einer protestgeprägten Nischenpartei zu einer Volkspartei zu entwickeln. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, bemüht sie sich zunehmend um die Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Strategie wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, insbesondere angesichts der scharfen migrationskritischen Rhetorik und Forderungen der Partei. Doch es gibt spezifische Gründe und Zielgruppen, die die AfD in ihrer Kampagne fokussiert.
Laut dem Soziologen Özgür Özvatan liegt die Zustimmung zur AfD unter den traditionellen konservativen Wählergruppen bei etwa 20 bis 25 Prozent, was die Partei an ihre natürliche Obergrenze bringt. Um jedoch die für eine Volkspartei notwendigen 30 Prozent oder mehr zu erreichen, ist es entscheidend, neue Wählergruppen zu erschließen. Dazu zählen Menschen mit Migrationshintergrund, die heute etwa 42 Prozent der unter 20-Jährigen in Deutschland ausmachen. Speziell um diese Gruppe wirbt die AfD aktiv, insbesondere über Social-Media-Plattformen wie TikTok, deren Empfehlungsalgorithmen gezielte Botschaften an spezifische Zielgruppen senden.
Innerhalb der Menschen mit Migrationshintergrund gibt es Wählergruppen, die der AfD bereits nahestehen. Dazu zählen insbesondere Russlanddeutsche, die sich von der AfD repräsentiert fühlen. Aber auch türkeistämmige und muslimische Gruppen werden gezielt angesprochen. Dabei fokussiert die Partei auf spezifische Anliegen, wie Kritik an der sogenannten Frühsexualisierung in Schulen oder den Erhalt traditioneller Familienwerte. Besonders bei Migranten, die den politischen Islam in ihren Herkunftsländern kritisch erlebt haben, scheint die AfD erfolgreich zu sein. Diese Menschen teilen zwar eine muslimische Identität, fühlen sich jedoch durch migrationskritische oder islamkritische Haltungen nicht notwendigerweise abgeschreckt.
Die gezielte Ansprache von Migranten durch die AfD wirft jedoch Fragen auf. Wie können Menschen mit Migrationshintergrund eine Partei unterstützen, die durch Slogans wie „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ geprägt ist? Aus der Migrationsforschung weiß man, dass es innerhalb von Migranten-Communities oft Generationenunterschiede gibt. Menschen, die selbst eingewandert sind und Herausforderungen bei der Integration gemeistert haben, entwickeln mitunter migrationsskeptische Positionen. Sie empfinden neue Einwanderungswellen als ungerecht, da sie das Gefühl haben, dass spätere Generationen von Vorteilen profitieren, die ihnen selbst nicht zuteilwurden.
Eine wichtige Rolle in der Strategie der AfD spielt die digitale Kommunikation. Während etablierte Parteien wie die SPD und die Grünen als traditionelle Vertreter von Migrantenanliegen gelten, haben sie laut Özvatan einen großen Nachholbedarf in der digitalen Ansprache. Die AfD ist hier „mindestens zwei Schritte weiter“ und nutzt Social Media gezielt, um migrantische Zielgruppen zu mobilisieren, ohne ihre traditionelle Wählerschaft zu verprellen. Dank der Algorithmen von Plattformen wie TikTok bleibt die spezifische Ansprache an Migranten weitgehend unsichtbar für die übrigen AfD-Wähler, wodurch interne Konflikte minimiert werden.
Obwohl die Strategie der AfD, um Migrantenstimmen zu werben, erfolgreich sein könnte, bleibt sie ein zweischneidiges Schwert. Die Partei sendet nach außen widersprüchliche Signale: Einerseits werden migrantische Gruppen aktiv umworben, andererseits bleiben abfällige Äußerungen und Forderungen nach „Remigration“ ein zentraler Bestandteil ihrer Programmatik. Dennoch zeigt die Resonanz auf die Strategie, dass es innerhalb migrantischer Gemeinschaften Wähler gibt, die sich von etablierten Parteien nicht mehr repräsentiert fühlen und die AfD als Alternative betrachten.
Der Text ist KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.
Quellen
Wie die AfD um Migranten wirbt – und sie zugleich verunglimpft
14. August 2024 — Sozialwissenschaftler Özgür Özvatan von der Humboldt-Universität sieht im Interview mit dem ARD-Politikmagazin "report München" eine neue Strategie der AfD: "Seit dem letzten Sommer hat die AfD angefangen, aktiv um migrantische Stimmen zu werben, vor allen Dingen auf Social Media.
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/wie-die-afd-um-migranten-wirbt-und-sie-zugleich-verunglimpft,ULMTffm
Die AfD auf Stimmenfang bei Migranten: Ein Soziologe ordnet ein
Grösste Gewinnerin könnte die Rechtsaussenpartei AfD werden. Mittlerweile wirbt die AfD gezielt um die Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Soziologe erklärt, was die …
Wieso die deutsche AfD gezielt um «Migrantenstimmen» wirbt
18. August 2024 — Mit ihrem Anti-Migrations-Diskurs zielt die AfD vor allem auf nationalistische Kreise. Gleichzeitig wirbt die Partei um Stimmen von Deutschen mit Migrationshintergrund. Das Gespräch mit dem…
https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/wieso-die-deutsche-afd-gezielt-um-migrantenstimmen-wirbt
Wie die AfD um Migranten wirbt - und "Remigration" fordert
2. April 2024 — Die AfD wirbt gezielt um Menschen mit Migrationshintergrund - dabei fordert sie in Teilen "Remigration". Wie passt das zusammen?
Die AfD und Migranten: Ein zynisches Doppelspiel? | BR.de
13. August 2024 — Özgür Özvatan, Institut für Sozialwissenschaften Humboldt-Universität Berlin Teil
Experte erwartet „gewisse Unterstützung für die AfD“ unter Migranten
Was wäre, wenn Populisten in Brühl mehr Gewicht im Rat hätten?
Eine KI-gernerierte Analyse
Prompt: Formuliere Fragen, die man die AfD fragen müsste, um zu prüfen, ob wirklich ein weiterführendes Politikverständnis oder eher Populismus hinter ihrer Kritik steht.
- Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor, um die geplante Kreditaufnahme in Höhe von € 24,1 Mio zu vermeiden, ohne wichtige kommunale Dienstleistungen einzuschränken?
- Wie wollen Sie Einnahmeausfälle kompensieren, wenn Sie Steuererhöhungen ablehnen? Gibt es alternative Ansätze, um die Einnahmen der Kommune zu steigern?
- Welche Einsparpotenziale sehen Sie in Brühl? Können Sie konkrete Posten im Haushalt benennen, die Ihrer Meinung nach verzichtbar sind?
- Sie betonen die hohen Kosten der Migration. Können Sie detailliert aufschlüsseln, wie viel Prozent des kommunalen Haushalts tatsächlich für Geflüchtete und Migranten verwendet wird?
- Wie würden Sie sicherstellen, dass Einsparungen im Sozialbereich nicht zulasten anderer vulnerabler Gruppen wie Senioren, Familien oder Menschen mit Behinderungen gehen?
- Sie kritisieren Steuererhöhungen für Bürger und Unternehmen. Welche Investitionen in Infrastruktur oder Bildung würden Sie trotz eines Haushaltsdefizits priorisieren, um Brühl wirtschaftlich attraktiv zu halten?
- Wie wollen Sie sicherstellen, dass Unternehmen weiterhin bereit sind, in Brühl zu investieren, wenn gleichzeitig Einsparungen oder Steuerkürzungen den Haushalt belasten?
- Welche Pläne haben Sie, um den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel in Brühl zu adressieren?
- Sie lehnen Klimaschutzmaßnahmen ab, die mit Kosten verbunden sind. Welche Alternativen bieten Sie, um Brühl dennoch an den Folgen des Klimawandels wie Hochwasser oder Hitzewellen anzupassen?
- Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach der Ausbau erneuerbarer Energien oder nachhaltiger Stadtentwicklung in der kommunalen Politik spielen?
- Sie betonen, dass rot-grüne Politik die Probleme verursacht. Welche politischen Ziele verfolgen Sie, um langfristig stabile Kommunalfinanzen zu gewährleisten?
- Wie wollen Sie verhindern, dass populistische Rhetorik die politische Zusammenarbeit im Rat behindert und konstruktive Lösungen erschwert?
- Welche Pläne haben Sie, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brühl zu fördern, insbesondere angesichts der Polarisierung durch Migrationsthemen?
- In anderen Gemeinden, wo populistische Parteien Einfluss gewonnen haben, gab es teils negative Entwicklungen (z. B. Sonneberg). Was würden Sie anders machen, um solche Probleme in Brühl zu vermeiden?
- Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Vorschläge nicht nur Kritik äußern, sondern umsetzbare und rechtskonforme Lösungen beinhalten?
Prompt:
Bitte entwirf einen Artikel mit dem Titel "Was wäre, wenn Populisten in Brühl mehr Gewicht im Rat hätten?" - Fließtext für interessierte Leser*innen - mit Querverweis auf Erfahrungen mit Sesselman.
Populismus ist ein Schlagwort, das oft die politische Debatte prägt, besonders in Krisenzeiten. Was aber passiert, wenn populistische Parteien tatsächlich mehr Einfluss gewinnen? Ein Blick nach Brühl könnte bald zeigen, wie sich solche Veränderungen konkret auswirken – oder nicht. Ein Jahr mit Robert Sesselmann, dem ersten AfD-Landrat in Sonneberg, gibt einen Einblick in die Chancen und Risiken, die mit populistischer Politik einhergehen. Doch welche Parallelen lassen sich ziehen, und was könnten die Konsequenzen für Brühl sein?
Der Haushaltsentwurf und populistische Versprechen
In Brühl steht der Haushaltsentwurf 2025 im Fokus. Er zeigt ein Defizit von 24,1 Millionen Euro, das nur durch Kreditaufnahme gedeckt werden kann. Zugleich sind Steuererhöhungen und Eingriffe in die Rücklagen der Stadtwerke geplant – Maßnahmen, die populistische Kräfte mit scharfer Kritik begleiten. Ihre Rhetorik ist klar: „Die rot-grüne Mehrheit und die Migrationspolitik treiben Brühl in den Ruin.“
Dieses Narrativ folgt einem bewährten populistischen Muster: Schuldzuweisung und Vereinfachung. Komplexe Haushaltsprobleme werden auf ein oder zwei Faktoren reduziert. Wichtige Fragen – etwa, wie man Einnahmen ohne Steuererhöhungen steigern oder Sozialausgaben nachhaltig finanzieren könnte – bleiben unbeantwortet. Solche Positionen mögen Wähler mobilisieren, aber was passiert, wenn diese Kräfte tatsächlich die Mehrheit im Rat erlangen?
Ein Blick nach Sonneberg
Die Erfahrungen in Sonneberg, wo die AfD mit Robert Sesselmann einen Landrat stellt, bieten ein Fallbeispiel. Sesselmann trat mit einem klaren populistischen Programm an: weniger Bürokratie, weniger Migration, weniger Klimaschutzauflagen. Doch ein Jahr nach seiner Wahl zeigt sich: Die Realität der Verwaltung stellt populistische Versprechen oft auf die Probe.
Sesselmann musste geltendes Recht umsetzen, Asylsuchende aufnehmen und Bundesgesetze wie das Heizungsgesetz befolgen. Die Zwänge des Amtes entzauberten schnell den Mythos, dass populistische Politik alles anders machen könnte. Doch statt pragmatische Lösungen zu finden, setzte er in sensiblen Bereichen gezielte Stiche: Die Entlassung von Sozialarbeitern in Flüchtlingsunterkünften und der Versuch, Förderprogramme wie „Demokratie leben“ zu streichen, sorgten für Polarisierung, aber kaum greifbare Ergebnisse.
Parallelen und mögliche Entwicklungen in Brühl
Sollte eine populistische Partei wie die AfD in Brühl an Einfluss gewinnen, könnte sich eine ähnliche Dynamik entfalten:
Symbolische Maßnahmen statt struktureller Lösungen: Es ist wahrscheinlich, dass populistische Akteure vor allem Themen aufgreifen, die emotionalisieren – etwa Migration oder Steuererhöhungen –, ohne die finanziellen Herausforderungen ganzheitlich anzugehen. Solche Strategien lenken ab, führen aber selten zu nachhaltigen Verbesserungen.
Polarisierung statt Konsens: Populistische Rhetorik lebt von klaren Feindbildern. In Brühl könnten rot-grüne Parteien und ihre Unterstützer zum Hauptgegner stilisiert werden. Dies würde die politische Zusammenarbeit im Rat erschweren und den gesellschaftlichen Zusammenhalt belasten.
Verwaltungshürden: Wie in Sonneberg wären auch in Brühl die Möglichkeiten populistischer Politik durch Gesetze und Vorgaben begrenzt. Große Versprechen könnten schnell an der Realität scheitern. Dies würde einerseits die Unzufriedenheit der Wählerschaft verstärken, andererseits aber auch zeigen, dass populistische Politik wenig Substanz hat.
Die Rolle der Bürgerinnen und Bürger
Die Erfahrungen in Sonneberg verdeutlichen, dass Populismus kurzfristig mobilisieren, langfristig aber enttäuschen kann. In Brühl könnten ähnliche Entwicklungen drohen: Lautstarke Rhetorik und Schuldzuweisungen, die keine echten Antworten liefern. Gleichzeitig zeigt der Widerstand gegen Sesselmann in Sonneberg – etwa durch Bürgerbewegungen wie „Sonneberg zeigt Haltung“ –, dass zivilgesellschaftliches Engagement eine starke Gegenkraft sein kann.
Die entscheidende Frage bleibt: Wie können Brühlerinnen und Brühler sicherstellen, dass ihre Stadt nachhaltige und pragmatische Lösungen verfolgt? Es liegt an den Wählerinnen und Wählern, durch informierte Entscheidungen und kritisches Hinterfragen populistischer Versprechen eine Richtung vorzugeben.
Fazit
Populismus bietet oft einfache Antworten auf komplexe Probleme. Doch Beispiele wie Sonneberg zeigen, dass solche Strategien in der Praxis scheitern können. Für Brühl bedeutet dies, wachsam zu bleiben und darauf zu achten, dass die politischen Akteure nicht nur Kritik äußern, sondern auch konstruktive Lösungen anbieten. Denn eines ist sicher: Lautstarke Forderungen mögen Aufmerksamkeit erregen, aber am Ende entscheiden die Ergebnisse, ob eine Politik wirklich tragfähig ist.
ChatGPT bekam vor allem diese Quellen und sollte zudem selbst recherchieren:
- Was passiert, wenn die AfD das sagen hat? - Ein Jahr mit Robert Sesselmann, dem ersten und einzigen Landrat der AfD
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2024/33/robert-sesselmann-afd-landrat-sonneberg-thueringen/komplettansicht
- Text zur AfD-Mitteilung: In Brühl wächst der Schuldenberg weiter - gefunden auf Facebook
https://www.facebook.com/groups/1501149036840204/permalink/3917032065251877/
Der Text ist abgesehen von den Zitaten KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.
SWR2 Zeitgenossen: Andreas Zick: „Rechtsextremismus ist in der Mitte verankert“
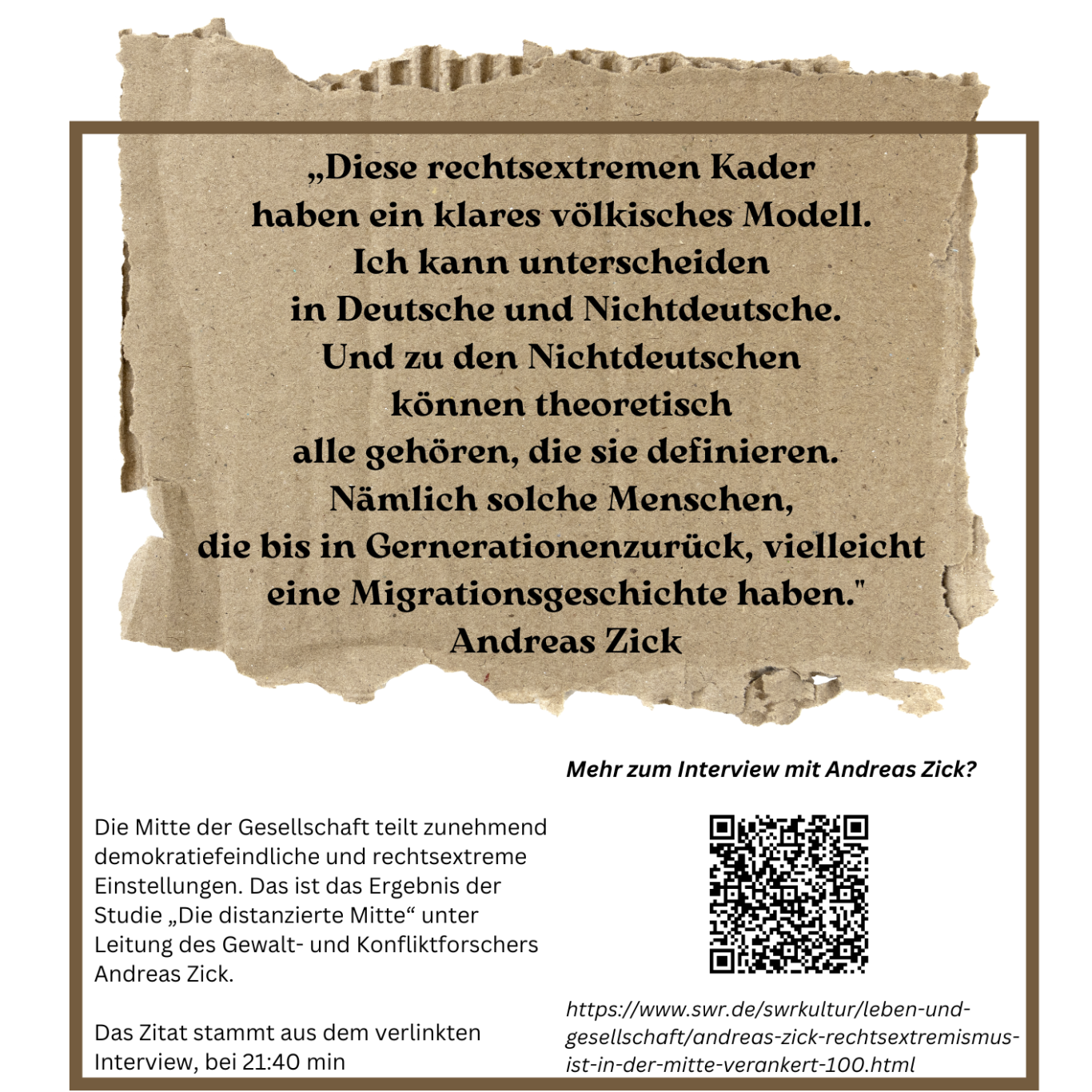
21.12.24
In der SWR2-Sendung "Zeitgenossen" vom 21. Dezember 2024 spricht der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick über die Ergebnisse der Studie "Die distanzierte Mitte". Diese Untersuchung zeigt, dass rechtsextreme Einstellungen in Deutschland zunehmen und zunehmend in der gesellschaftlichen Mitte verankert sind. Konkret hat jede zwölfte Person ein rechtsextremes Weltbild, und fast ein Drittel der Bevölkerung teilt völkische Ansichten.
Zick betont, dass rechtsextreme Positionen zunehmend normalisiert werden. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass die AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer demokratiegefährdenden und menschenfeindlichen Parolen gewählt wird. Die Studie verdeutlicht, dass die Mitte der Gesellschaft zunehmend demokratiefeindliche und rechtsextreme Einstellungen teilt.
Die vollständige Studie "Die distanzierte Mitte" wurde von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht und bietet eine umfassende Analyse rechtsextremer und demokratiegefährdender Einstellungen in Deutschland für die Jahre 2022/23.
Für weitere Informationen und das vollständige Interview mit Andreas Zick besuchen Sie die Webseite der SWR2-Sendung.
Audio: 45 Minuten
Rassismus überwinden
Herausforderungen und Chancen für eine gerechte Gesellschaft
Eine Gesellschaft ohne Rassismus ist gerechter, offener und zukunftsfähiger. Vielfalt ist dabei kein Risiko, sondern ein großer Gewinn: Sie bringt neue Ideen hervor, fördert Innovation und stärkt den Zusammenhalt. Wer Diskriminierung überwindet, legt den Grundstein für eine lebendige Demokratie, in der alle Menschen würdig behandelt werden und gleiche Chancen erhalten.
Früher wurde Rassismus vor allem über scheinbar „wissenschaftliche“ Thesen zur biologischen Überlegenheit bestimmter Gruppen begründet. Kolonialmächte im 19. Jahrhundert behaupteten etwa, ihre eigene „Rasse“ sei von Natur aus klüger, stärker oder zivilisierter als andere, um Eroberung und Unterdrückung zu rechtfertigen. Menschen mit dunkler Hautfarbe oder aus vermeintlich „primitiven“ Gesellschaften galten als biologisch minderwertig – eine unbelegte Annahme, die dennoch Einfluss auf Politik, Bildung und Alltag hatte.
Im 20. Jahrhundert veränderte sich die Argumentation. Statt von „Rassen“ sprach man nun von „Kulturen“. Bestimmte Lebensweisen, Traditionen oder Werte wurden pauschal als rückständig, unvereinbar oder minderwertig dargestellt. Heute heißt es oft, manche Kultur passe nicht in die Mehrheitsgesellschaft, sei „fremdartig“ oder störend. Damit verschoben sich die Vorurteile vom Biologischen ins Kulturelle – subtiler, aber ebenso wirksam: Menschen werden weiterhin in „Wir“ und „Andere“ geteilt, ein faires Miteinander blockiert.
Auch institutionelle Strukturen können Rassismus festigen, etwa wenn bestimmte Gruppen bei Bildung, Arbeit oder politischer Teilhabe benachteiligt werden. Wird dieser institutionelle Rassismus abgebaut, profitieren alle: Bildung, Jobs und politische Mitbestimmung stehen dann nicht länger nur einzelnen Gruppen offen, sondern verteilen sich gerechter. Das stärkt das Vertrauen in staatliche Einrichtungen, nutzt vielfältige Talente und führt zu einer demokratischeren, gerechteren Gemeinschaft.
Die Überwindung von Rassismus schafft ein inklusives Umfeld, in dem sich alle frei entfalten können. Das steigert nicht nur die Lebensqualität Einzelner, sondern stärkt die gesamte Gesellschaft: Wer Vielfalt anerkennt, setzt auf ein breites Spektrum an Talenten, Ideen und Kompetenzen. So entstehen kreative Lösungen für wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Studien zeigen, dass vielfältige Teams erfolgreicher sind und Arbeitsmärkte stabiler werden, wenn alle die gleichen Chancen erhalten. Auch der Glaube an demokratische Institutionen wächst, wenn erkennbar ist, dass diese auf Gerechtigkeit und Respekt beruhen.
Kurz gesagt: Vielfalt ist ein Motor für Fortschritt. Werden Barrieren abgebaut und Vorurteile überwunden, wächst das Vertrauen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. So entsteht ein Klima gegenseitiger Wertschätzung, das ein harmonisches Zusammenleben fördert – eine Gesellschaft, in der Offenheit statt Ausgrenzung den Weg weist.
Quellen und Vertiefung
Bertelsmann Stiftung: "Willkommenskultur in Krisenzeiten"
https://migrant-integration.ec.europa.eu/library-document/willkommenskultur-krisenzeiten-wahrnehmungen-und-einstellungen-der-bevoelkerung-zu_de
Hier finden Sie eine umfassende Analyse, wie Willkommenskultur in Deutschland wahrgenommen und gestaltet wird.
Domberg-Akademie: "Wie Vielfalt in der Gesellschaft sichtbarer werden kann"
https://www.domberg-akademie.de
Diese Seite diskutiert Ansätze und Projekte, um gesellschaftliche Vielfalt sichtbar und wertschätzend zu fördern.
Bundeszentrale für politische Bildung: "Anmerkungen zur Willkommenskultur"
https://www.bpb.de
Ein Beitrag zur Debatte um Willkommenskultur und deren Auswirkungen auf gesellschaftliche Integration und Zusammenhalt.
Amnesty International: "Sieben Gründe: Sei aktiv antirassistisch"
https://www.amnesty.de/sieben-gruende-fuer-einsatz-gegen-rassismus
Amnesty International gibt praktische Gründe und Handlungsansätze, warum und wie Antirassismus aktiv unterstützt werden sollte.
"Antirassismus ist systemrelevant für unsere Demokratie"
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/antirassismus-ist-systemrelevant-fuer-unsere-demokratie-2156996
Ein Lagebericht zu Rassismus in Deutschland, mit Fokus auf Handlungsfelder und Maßnahmen zur Förderung antirassistischer Strukturen.
Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft: Aktuelles aus der Rechtsextremismusforschung
https://www.idz-jena.de/wsddet/aktuelles-aus-der-forschung-bereich-rechtsextremismusforschung
Eine Plattform mit Studien und Berichten zu rechtsextremistischen Strukturen und Ansätzen zur Stärkung von Demokratie und Antirassismus.
Der Text ist abgesehen von den Zitaten KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.
Wenn Theorie auf bittere Realität trifft
Physikalische Chemie des Klimawandels
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y4fAKSO5AjU
1 Std. 22 Min.
Vorlesung von Prof. Dr. Seiffert, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Von der historischen Erfindung der Dampfmaschine bis zur globalen Erwärmung – eine neu aufbereitete Vorlesung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beleuchtet die physikalisch-chemischen Grundlagen unseres sich rasant ändernden Klimas.
Mainz, 29. November 2024. Vor genau fünf Jahren, im Rahmen der Aktion „Lectures for Future“, hielt ein Dozententeam an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine besondere Vorlesung: „Die Physikalische Chemie des Klimawandels“. Ziel war es, die fundamentalen wissenschaftlichen Zusammenhänge hinter der Erderwärmung aufzuzeigen, basierend auf thermodynamischen Gesetzen, molekularer Spektroskopie und Strahlungsbilanzen. Die Veranstaltung vor fünf Jahren fiel in eine Zeit, in der gesellschaftliche Zuversicht noch groß schien. Fridays for Future-Demonstrationen bewegten Millionen weltweit, die Forderungen nach konsequentem Klimaschutz waren laut, klar und dringlich.
Nun, Ende 2024, wurde dieselbe Vorlesung neu aufgelegt – nicht nur um die wissenschaftlichen Inhalte zu wiederholen, sondern vor allem, um zu reflektieren, wie sich die Situation seither verändert hat. Die naturwissenschaftlichen Fakten haben sich nicht grundlegend gewandelt. Was sich indes massiv verändert hat, ist unser Blick darauf, wie weit die globale Erwärmung bereits fortgeschritten ist und wie gering die tatsächlichen Fortschritte in puncto Klimaschutz geblieben sind.
Von der Thermodynamik zur Treibhauswirkung
Die Grundlage der Vorlesung bildet die Thermodynamik, das physikalisch-chemische Fundament unseres Energieverständnisses. In den ersten Semestern der Physikalischen Chemie lernen Studierende die Konzepte von Energie und Entropie kennen, analysieren Wärmeflüsse, Gleichgewichte und Umwandlungsprozesse. Diese Grundlagen sind unmittelbar relevant für das Klima: Die Erde befindet sich in einem Strahlungsgleichgewicht mit der Sonne. Ohne eine Atmosphäre wäre es hier im globalen Mittel fast 33 Grad kälter. Dass wir in einer bewohnbaren Welt leben, verdanken wir dem natürlichen Treibhauseffekt, vor allem durch Wasserdampf.
Doch seit Beginn der Industrialisierung hat der Mensch massiv in dieses System eingegriffen. Der Ausstoß von Kohlendioxid (CO₂) und anderen Treibhausgasen, vorangetrieben durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in Wärmekraftmaschinen, Kraftwerken und Fahrzeugen, verändert die Zusammensetzung der Atmosphäre. CO₂ füllt Infrarot-Fenster, die zuvor offen waren, und verstärkt so den Treibhauseffekt. Die Folge: Ein Temperaturanstieg, der längst nicht mehr nur ein Zukunftsszenario ist. Er ist Realität – spürbar in Extremwetterlagen, immer häufigeren Hitzewellen, Starkregenereignissen und Dürren.
Die beunruhigende Gegenwart
Waren vor fünf Jahren vage Hoffnungen auf ein rasches politisches und gesellschaftliches Umsteuern noch präsent, so ist die Lage heute ernüchternd. Die globale Durchschnittstemperatur hat markant zugelegt, Kipppunkte im Klimasystem nähern sich. Wettermoderatorinnen und Meteorologinnen berichten inzwischen regelmäßig von Ereignissen, die statistisch kaum noch fassbar sind – etwa Regenmengen, die in wenigen Stunden ein ganzes Jahresmittel übersteigen, oder Hitzerekorde, die nicht mehr im Zehntelbereich, sondern in ganzen Gradschritten nach oben schnellen.
Die Vorlesung machte deutlich, dass dieser Anstieg physikalisch leicht nachvollziehbar ist: Steigt die Meerestemperatur nur um wenige Grade, erhöht sich der Wasserdampfgehalt der Luft um mehrere Prozent. Diese zusätzliche latente Wärme führt zu intensiveren Wetterextremen. Physikalisch gesehen ist das nicht überraschend – es ist die konsequente Folge thermodynamischer und spektroskopischer Gesetze, die Studierende der physikalischen Chemie in ihrem Grundstudium erlernen.
Komplexe Systeme, komplexe Gesellschaften
Ein weiterer Schwerpunkt der Vorlesung lag auf der Komplexität des Klimasystems. Rückkopplungen und nicht-lineare Effekte kennzeichnen komplexe Systeme. Wird ein Kipp-Punkt überschritten, können unkontrollierbare und dauerhafte Zustandsänderungen folgen. Damit ist der Klimawandel nicht nur ein physikalisch-chemisches Problem, sondern auch eine soziale Herausforderung. Gesellschaftliche Systeme sind ebenso komplex und reagieren empfindlich auf Destabilisierung durch umweltbedingte Krisen. Jede versäumte Maßnahme zur Emissionsminderung erhöht die Risiken für politische, soziale und wirtschaftliche Instabilität.
Die Physik ist eindeutig – die Handlungsspielräume schrumpfen
Die Botschaft der Vorlesung war klar: Die wissenschaftliche Evidenz ist erdrückend, die natürliche und menschliche Welt stehen unter Druck. Während vor fünf Jahren noch ein Fenster der handhabbaren Transformation offen zu stehen schien, hat sich dieses heute nahezu geschlossen. Die Mathematik der Klimagleichungen lässt wenig Spielraum: Um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, müsste die Weltgemeinschaft ihre Emissionen so schnell reduzieren, wie es bislang nur in Notstandssituationen gelang. Selbst für 2 oder 3 Grad gelten dieselben Grundregeln – ohne letztliche Nullemissionen ist das Klimasystem nicht zu stabilisieren, nur der Zeitpunkt, an dem wir dieses Ziel erreichen müssen, variiert.
Menschlichkeit in ungewissen Zeiten
Die Vorlesung endete ohne bequeme Beruhigung. Niemand konnte verlässliche Hoffnung versprechen, dass sich das Blatt noch entscheidend wenden lässt. Die Referierenden forderten stattdessen auf, nicht in Fatalismus zu verfallen, sondern Menschlichkeit zu wahren und zu handeln – trotz der Härte der Fakten. Denn selbst wenn wir den Klimawandel nicht mehr vollständig aufhalten können, ist es entscheidend, ihn so weit wie möglich einzudämmen und auf diese Weise Leid zu verringern. Jede vermiedene Tonne CO₂, jeder eingesparte Kubikmeter Gas, jede weise politische Entscheidung zählt.
Am Ende schloss sich der Kreis zur Sondervorlesung von 2019: Die physikalisch-chemischen Grundlagen sind dieselben geblieben, doch die äußeren Umstände haben sich dramatisch verschoben. Dieses Mal steht nicht nur die Wissenschaft, sondern unsere gesamte Gesellschaft auf dem Prüfstand. Und genau das machte die erneuerte Vorlesung überdeutlich.
Was stellen sich die Bäume in Brühl denn so an?
Von lokalen Baumfällungen und Klimadebatten in sozialen Medien: Wie der Klimawandel politische Fronten verhärtet
Ein Facebook-Chatverlauf zu den geplanten Baumfällungen in Brühl verdeutlicht, wie stark ein scheinbar lokales Thema wie Reaktionen auf den Klimawandel und Hitze Schäden emotionalisiert und politisiert werden kann. Während die Stadt die Notwendigkeit der Fällungen mit den Schäden durch den Klimawandel begründet, wird diese Aussage von einigen Kommentierenden in Frage gestellt und sogar als Teil einer größeren "Lügenstrategie" dargestellt.
„Bäume sterben langsam“ – Verleugnung oder Unverständnis?
Ein zentraler Streitpunkt in der Diskussion ist die Verwechslung von Wetter und Klima, die sich durch mehrere Beiträge im Chatverlauf zieht. Kommentare wie „Welcher Klimawandel? Und heiß? Wann? Wo?“ (D. S.) oder „Ich war von März bis Anfang Dezember in Brühl. Bis Anfang August hat es geschifft. Dann dreimal mit Abstand je 2 Tage heiß und seit Oktober wieder regnerisch“ (G. C.) deuten darauf hin, dass einzelne Wettermuster oft als Beleg für oder gegen den Klimawandel interpretiert werden. Dabei ist wissenschaftlich klar, dass Wetter kurzfristige, lokale Schwankungen beschreibt, während Klima langfristige Trends umfasst.
Derartige Verwechslungen fördern Missverständnisse und stärken den Eindruck, dass wissenschaftliche Aussagen widersprüchlich oder falsch seien. Studien, wie die des IPCC, zeigen jedoch, dass die globale Erwärmung langfristig die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen erhöht, unabhängig von kurzfristigen Regen- oder Kälteperioden. Diese fundamentale Unterscheidung wird in den Diskussionen häufig ignoriert, was die Polarisierung weiter verstärkt. Ein zentraler Streitpunkt in der Diskussion ist die Wahrnehmung des Klimawandels selbst. Während T. E. trocken kommentiert: „Bäume sterben langsam“, wird diese eher sachliche Beobachtung von anderen Stimmen wie J. R. stark emotionalisiert. Er schreibt: „Diese Lügen sind echt nicht mehr zu ertragen!“ Damit bringt er eine häufig anzutreffende Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erklärungen zum Ausdruck, die oft auf einer grundsätzlichen Ablehnung von Expertenwissen basiert. Studien des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zeigen jedoch unmissverständlich, dass die Häufigkeit von Dürren, Hitzewellen und Extremwetterereignissen durch den Klimawandel zunimmt. Die Schäden an Bäumen sind also keine isolierten Ereignisse, sondern stehen im größeren Kontext der globalen Erwärmung.
„Entscheidend sei in jedem Fall, wie stark die Forstwirtschaft eingreift“
M. V.s Beitrag lenkt die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Forstwirtschaft bei der Baumproblematik. Mit einem Zitat aus der GEO unterstreicht er: „Entscheidend sei in jedem Fall, wie stark die Forstwirtschaft eingreift, wie viele Bäume gefällt werden.“ Er führt weiter aus: „Da kommt Sonne rein, da kommt Wind rein. Die Bäume geraten in Stress.“ Diese Perspektive beleuchtet die Schwächung von Ökosystemen durch aufgelichtete Wälder und intensive Bewirtschaftung. Die Öffnung der Baumkronen führt zu mehr direkter Sonneneinstrahlung und stärkeren Windeinflüssen, wodurch verbleibende Bäume empfindlicher gegenüber Trockenheit und Schädlingen werden.
Allerdings greift diese Argumentation zu kurz, wenn sie die Klimafolgen relativiert. Der IPCC-Bericht weist darauf hin, dass Extremwetterereignisse, steigende Temperaturen und längere Trockenperioden die Widerstandskraft von Bäumen zusätzlich schwächen. Dass ausgedünnte Wälder und Parks in früheren Jahrzehnten stabiler waren, zeigt vielmehr, dass sich die Belastung durch Klimawandel und intensive Landnutzung gegenseitig verstärken. Eine einseitige Fokussierung auf die Forstwirtschaft verschiebt somit die Ursachenfrage, ohne das grundlegende Problem zu entschärfen.
Der Kontext des GEO-Artikels macht deutlich, dass eine nachhaltigere Forstwirtschaft zwar essenziell ist, aber allein nicht ausreicht. Die Kombination aus menschlichen Eingriffen und Klimaveränderungen erfordert ein integriertes Vorgehen, das sowohl ökologische als auch klimapolitische Maßnahmen umfasst. Nur so können Wälder und Parks langfristig geschützt und widerstandsfähig gemacht werden.
Rolle sozialer Medien: Verstärker von Konflikten
Soziale Medien spielen eine zentrale Rolle in solchen Diskussionen, da sie Polarisierung und emotionalisierte Debatten begünstigen. Algorithmen priorisieren Inhalte, die hohe Interaktionen erzeugen, was oft zu einer Dominanz von polemischen oder populistischen Beiträgen führt. Kommentare wie „Achtung, zu viele Belege sind nicht erwünscht“ (T. K.) spiegeln nicht nur Ironie, sondern auch eine Abwehrhaltung wider, die durch das Gefühl von Überforderung oder Misstrauen gegenüber Institutionen geprägt ist. Expertenmeinungen und evidenzbasierte Beiträge, wie sie in den IPCC-Berichten zu finden sind, haben es in diesem Umfeld oft schwer, Gehör zu finden.
E. Felder, Sprachwissenschaftler und Experte für populistische Rhetorik, beschreibt treffend: „Populistisches Sprechen schürt Angst, grenzt aus und homogenisiert die Vielfalt der Interessen und Ideen.“ Dieses Zitat, entnommen aus einem Interview mit Zeit Online vom 5. August 2018, beleuchtet, wie populistische Sprache komplexe Themen vereinfacht und den Fokus von wesentlichen Problematiken wie der Klimakrise ablenkt. Während solche Rhetorik oft emotionalisiert, geraten die eigentlichen Probleme, wie etwa die Kombination aus Klimawandel und menschlichen Eingriffen, in den Hintergrund.
Warum sperren sich Menschen gegen den Klimawandel?
Die Ablehnung des Klimawandels lässt sich oft auf psychologische und soziologische Faktoren zurückführen. Der Klimawandel fordert tiefgreifende Änderungen unseres Lebensstils und wirtschaftlicher Strukturen, was viele als Bedrohung empfinden. Eine neue Studie der Universität Bonn und des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) zeigt, dass Klimawandelleugnung nicht primär auf Selbsttäuschung beruht. Stattdessen sehen die Forscher Anzeichen dafür, dass die Leugnung der menschgemachten Erderwärmung ein identitätsstiftendes Merkmal für bestimmte Gruppen sein kann. Für diese Gruppen ist das Leugnen nicht nur eine Überzeugung, sondern ein zentraler Bestandteil ihrer Abgrenzung von anderen politischen Lagern. Dadurch wird es schwierig, sie allein durch bessere Information zu erreichen.
Eine weitere Erklärung für die Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse liefert eine Studie des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Diese zeigt, dass Populismus und Verschwörungsmentalität einen gemeinsamen Kern haben: ein tiefes Misstrauen gegenüber Institutionen und sogenannten „Eliten“. Dieses dispositionelle Misstrauen führt dazu, dass wissenschaftliche Fakten oft als manipulativ oder eigennützig wahrgenommen werden. Populistinnen und Verschwörungsanhängerinnen neigen dazu, die Gesellschaft in einen binären Gegensatz von „wir“ und „die da oben“ zu teilen, was eine rationale Auseinandersetzung mit komplexen Themen erschwert.
„Motivated reasoning“ – das Biegen von Fakten zur Rechtfertigung klimaschädlichen Verhaltens – spielt laut der Bonner Studie hingegen eine geringere Rolle als bisher angenommen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Klimaleugnung oft weniger auf Unwissenheit, sondern auf Gruppenzugehörigkeit und ideologischen Überzeugungen basiert. Doch die Max-Planck-Studie weist darauf hin, dass das Misstrauen in Wissenschaft und Institutionen schädliche Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben kann. Vertrauen in transparente Kommunikation könnte ein Schlüssel sein, um Populismus und Wissenschaftsleugnung langfristig zu begegnen.
Ergebnis: Forderung nach faktenbasiertem Dialog
Die Debatte um die Baumfällungen in Brühl ist ein Beispiel dafür, wie lokale Themen als Projektionsfläche für größere gesellschaftliche Konflikte dienen können. Die emotionalisierte Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Simplifizierung komplexer Sachverhalte behindern jedoch den dringend notwendigen Dialog. Ein konstruktiver Umgang mit dem Klimawandel erfordert eine klare Kommunikation von Expert*innen, ergänzt durch Maßnahmen, die sowohl ökologisch als auch sozial tragfähig sind. Plattformen wie soziale Medien sollten stärker darauf abzielen, sachliche und faktenbasierte Diskussionen zu fördern, um den Kreislauf von Polarisierung und Misstrauen zu durchbrechen.
Bezug
- https://www.facebook.com/groups/1501149036840204/posts/3911180152503735/
- https://www.radioerft.de/artikel/klimawandel-und-hitze-setzt-bruehler-baeumen-zu-faellungen-2187799.html
Quellen
- IPCC-Bericht: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/07/SR1.5-SPM_de_barrierefrei.pdf
- Umweltbundesamt: https://www.umweltbundesamt.de/themen/ipcc-bericht-sofortige-globale-trendwende-noetig
- GEO-Artikel zur Forstwirtschaft: https://www.geo.de/natur/oekologie/warum-viele-baeume-ueberraschend-gut-durch-die-duerre-gekommen-sind-31787240.html
- Universität Bonn, Klimawandelleugnung: https://www.uni-bonn.de/de/neues/025-2024
- Max-Planck-Institut: https://www.mpg.de/20115581/0403-stra-wie-misstrauen-der-gesellschaft-schadet-151860-x
- Studien zu sozialer Medien-Polarisierung: https://www.bpb.de/themen/gesellschaft/algorithmen-und-polarisierung
- Zeit Online, Interview mit E. Felder: https://www.zeit.de/politik/2018-07/rhetorik-populismus-sprache-wissenschaft-erkennen
Zitatsammlung aus dem Chatverlauf
- „Bäume sterben langsam“ (T. E.): Dieser Beitrag hebt die natürlichen Prozesse des Baumsterbens hervor und vermeidet dabei jegliche Verbindung zum Klimawandel. Eine sachliche, aber unkritische Haltung.
- „Diese Lügen sind echt nicht mehr zu ertragen!“ (J. R.): Ausdruck starker Ablehnung gegenüber wissenschaftlichen Aussagen und ein Beispiel für die Emotionalisierung der Debatte.
- „Entscheidend sei in jedem Fall, wie stark die Forstwirtschaft eingreift“ (M. V.): Der Fokus wird auf menschliche Eingriffe und weniger auf den Klimawandel gelegt, was die Diskussion in eine andere Richtung lenkt.
- „Wie haben die Bäume das gemacht, bevor es Menschen gab?“ (S. M.): Eine rhetorische Frage, die den menschlichen Einfluss auf Ökosysteme infrage stellt und die Bedeutung von Klimaveränderungen relativiert.
- „Achtung, zu viele Belege sind nicht erwünscht“ (T. K.): Ironische Kritik an der vermeintlichen Überfrachtung der Diskussion mit Belegen, möglicherweise ein Hinweis auf Überforderung oder Skepsis.
Der Text ist abgesehen von den Zitaten KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.
Von der Straßenkriminalität zum digitalen Kulturkampf: Wie ein Raubüberfall politische Fronten verhärtet
Wenn Kriminalität zur politischen Waffe wird
15.12.2024
"Muss man wirklich mit Angst aus dem Haus gehen?" – S. G.
Der vorliegende Chatverlauf (*), der sich ursprünglich um einen Polizeibericht über einen Raubüberfall mit Messer in Brühl drehte, zeigt anschaulich, wie rasch ein lokaler Vorfall in eine hitzige politische Auseinandersetzung über Sicherheit, Migration und gesellschaftliche Werte münden kann. Die Debatte, die sich an der Tat entzündete, war derart von Emotionen, Vorurteilen und ideologischen Gräben geprägt, dass der Administrator schließlich die Kommentarfunktion ausgesetzt hat. Obwohl die eigentliche Straftat – eine Messerbedrohung im öffentlichen Raum – bereits für hohe emotionale Resonanz sorgt, dient der Vorfall im digitalen Diskurs vor allem als Auslöser einer vielschichtigen Debatte. Viele Kommentierende äußern steigende Besorgnis über die Sicherheitslage in Deutschland und verknüpfen diese umgehend mit Fragen der Migrationspolitik und politischen Handlungsfähigkeit. Während einige schärfere Strafen und konsequentere Abschiebungen fordern, werfen andere ihnen pauschalen Rassismus, Hass oder eine ideologische Instrumentalisierung des Geschehens vor. Auch Parteipolitik wird verhandelt, wenn die AfD als zukunftsweisende Kraft oder auf der anderen Seite als „Angstmacherin“ ins Spiel kommt.
"Hauptsache Bunt." – M. V.
Deutlich wird, dass das Thema Kriminalität längst kein rein rechtliches oder polizeiliches Problem mehr darstellt, sondern als politischer Brennstoff fungiert. Jede Andeutung, die Täter*innen könnten einen Migrationshintergrund besitzen, eröffnet eine Debatte, in der Einwanderung, Integration und kulturelles Zusammenleben neu verhandelt werden. Auf der einen Seite stehen jene, die sich von der Politik vernachlässigt fühlen und vor allem die öffentliche Ordnung bedroht sehen. Auf der anderen Seite mahnen Stimmen zur Differenzierung und warnen vor fremdenfeindlichen Stereotypen. Mitten in diesem Spannungsfeld prallen Weltanschauungen unvermittelt aufeinander: Während für die einen ein restriktiveres Vorgehen unverzichtbar scheint, betonen andere, dass sachliche Analysen unverzichtbar sind, um nicht im Strudel aus Vorurteilen und popkulturell befeuertem Populismus unterzugehen.
"Rassismus und Hetze kennt mal wieder keine Grenzen." – J. W.
Der Kern des Problems liegt in der emotionalen Überlagerung der Debatte. Die Furcht davor, selbst Opfer eines ähnlichen Verbrechens zu werden, erzeugt Angst, Empörung und den Wunsch nach sofortigen, harten Maßnahmen. Zugleich wird die Migrationsfrage – ohnehin ein hochsensibles, ideologisch aufgeladenes Feld – neu entfacht. Unterschiedliche politische Lager nutzen den Vorfall, um ihre Narrative zu bestätigen, und eine sachorientierte, lösungsorientierte Annäherung scheint unmöglich. Aggressive Tonlagen, beleidigende Unterstellungen, der Vorwurf der „Hassrede“ oder des „Toleranzbesoffenseins“ erschweren eine Annäherung zusätzlich. So verhärten sich die Fronten, statt Argumente faktenbasiert auszutauschen.
"Wir brauchen dringend ein paar Relativierungsversuche." – M. K.
Diese Dynamik bleibt ohne die Rolle sozialer Medien unvollständig. Online-Plattformen bieten zwar Raum für Austausch, verstärken jedoch bestimmte Tendenzen. Durch algorithmisch erzeugte Echokammern dominieren oft jene Meinungen, die der eigenen Überzeugung entsprechen. Differenzierte Perspektiven dringen schwerer durch. Die niedrigen Zugangsschwellen – spontane, anonyme Kommentare ohne redaktionelle Kontrolle – befördern ein raues Diskussionsklima. Wut, Empörung und verletzte Eitelkeiten münden in verbale Attacken, die im direkten Gespräch vielleicht nie geäußert würden. Informationen und Pseudo-Fakten verbreiten sich rasant, polemische Zuspitzungen erhalten mehr Aufmerksamkeit als fundierte Argumente. Anonymität senkt zudem die Hemmschwelle für scharfe Kritik – mit jeder weiteren emotionalen Reaktion heizt sich die Stimmung auf.
"Was würde in deinem Leben schlechter werden, wenn Gewalttäter ohne Dt. Pass in ihre Herkunftsländer abgeschoben würden?" – M. V.
Das Beispiel des Brühler Raubüberfalls zeigt exemplarisch, wie aus einem einzelnen, lokalen Verbrechen eine umfassende, ideologisch aufgeladene Debatte erwächst. Die komplexe Wechselwirkung aus Ängsten, Vorurteilen, politischen Absichten und digitaler Kommunikationsdynamik lässt am Ende das gesellschaftliche Klima weiter erkalten und treibt die Polarisierung voran – so weit, dass die Diskussion schließlich im virtuellen Raum abgewürgt werden musste. Dieser Vorfall steht damit nicht allein, sondern ist vielmehr Symptom einer tiefergehenden, gesellschaftlichen Herausforderung: Wie kann ein öffentlicher Diskurs gelingen, der Ängste ernstnimmt, aber dennoch faktenbasiert, respektvoll und lösungsorientiert bleibt, wenn Plattformen und Verhaltensweisen eher den gegenteiligen Effekt fördern?
(*) Bezug:
fb-Gruppe 50321 Brühl Artikel zum Polizeibereicht: "Räuber drohen mit Messer - Zeugen gesucht Brühl"
https://www.facebook.com/groups/1501149036840204/posts/3906934212928329
Der Text ist abgesehen von den Zitaten KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.
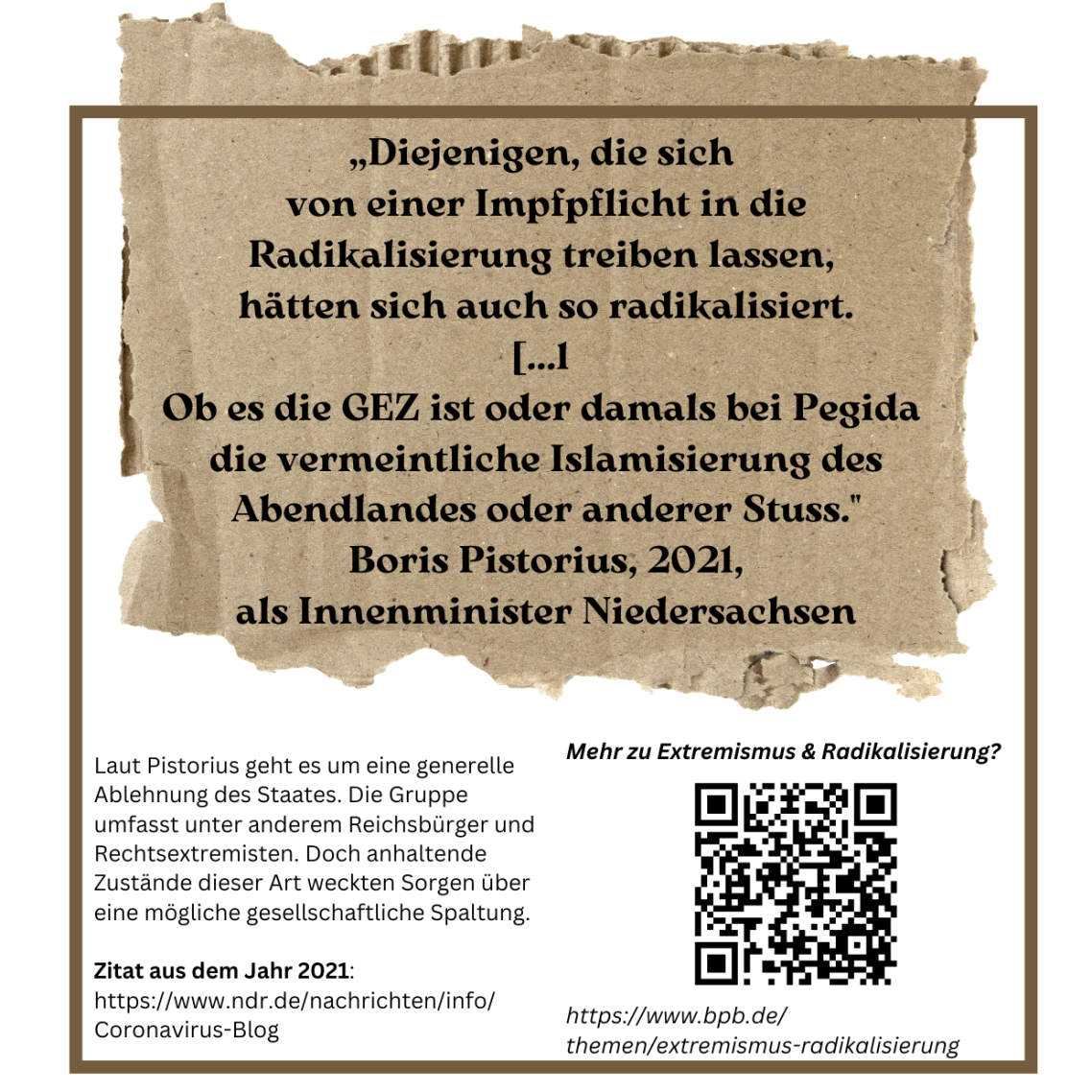
Pappweisheit:
Pistorius zur Radikalisierung 2021
Interessiert am Thema #Extremismus und #Radikalisierung? Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet eine Seite dazu an.
Quellensammlung: Messer, Gewalt und Kriminalität
Die Diskussion über Messerangriffe in Deutschland ist ein vielschichtiges Thema, das sowohl gesellschaftliche als auch mediale und politische Aspekte umfasst. Die unten stehenden Quellen und Perspektiven beleuchten zentrale Fragestellungen und Zusammenhänge.
1. Häufigkeit und Täterprofile
- Ahmad Mansour beleuchtet in seiner Kolumne die Rolle von Migranten in der Statistik und kritisiert die Ignoranz gegenüber tieferliegenden gesellschaftlichen Problemen. Quelle: Focus.
- Historische Vergleiche zeigen, dass die Diskussion über Messerangriffe keineswegs neu ist. Bereits in den 1960er-Jahren gab es ähnliche öffentliche Debatten. Quelle: Ruprecht Polenz auf Threads.
2. Jugendgewalt und Ursachen
- Studien zeigen, dass viele Jugendliche Messer aus Angst oder zur Selbstverteidigung mit sich führen. Quelle: ResearchGate.
- Ein Gutachten zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland unterstreicht die Bedeutung sozialer Faktoren. Quelle: BMFSFJ.
3. Mediale Darstellung und Wahrnehmung
- Der Podcast Synapsen – ein Wissenschaftspodcast analysiert das Bild der "gewalttätigen Jugend" und relativiert die Wahrnehmung von zunehmender Aggression. Quelle: NDR.
- Satirische Beiträge wie Die Anstalt hinterfragen die Diskrepanz zwischen gefühlter und realer Kriminalität. Quelle: ZDF.
4. Gesellschaftliche Zusammenhänge
- Die Autoritarismusstudie zeigt, dass wahrgenommene, nicht objektive Deprivation entscheidend für die Zustimmung zu autoritären Positionen ist. Quelle: Heinrich-Böll-Stiftung.
- Rechte Gewalt und die Bedrohung durch Extremismus sind ebenfalls zentrale Themen in der Diskussion um gesellschaftliche Sicherheit. Quelle: Deutschlandfunk.
5. Podcasts und Audio-Beiträge
- IQ – Wissenschaft und Forschung hinterfragt, ob Kriminalität in Deutschland tatsächlich zunimmt oder nur anders wahrgenommen wird. Quelle: BR.
- Der Podcast ZWEIvorZWÖLF diskutiert den Widerstand gegen Rechtsextremisten und deren Einfluss auf die gesellschaftliche Stimmung. Quelle: ZWEIvorZWÖLF.
Die Jugend von heute: Immer gewalttätiger? Gar nicht wahr!
Die Tücken des Umgangs mit der Kriminalstatistik
Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 22.11.2024 | 06:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic/Bent Freiwald
49 Min | Verfügbar bis 22.11.2029
https://www.ndr.de/nachrichten/info/113-Die-Jugend-von-heute-1-Immer-gewalttaetiger-Gar-nicht-wahr,audio1758752.html
KI-Quellrecheche und Zusammenfassung auf Grundlage der Shownotes
Die öffentliche Wahrnehmung von Jugendkriminalität ist oft von Vorurteilen geprägt, die nicht immer mit den tatsächlichen Daten übereinstimmen. In der Sendung "Synapsen – ein Wissenschaftspodcast" vom 22.11.2024 analysiert der Wissenschaftsjournalist Bent Freiwald gemeinsam mit Host Maja Bahtijarević Statistiken zur Jugendkriminalität und zeigt auf, dass viele Schlagzeilen einen nicht existierenden Trend suggerieren.
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS): Die PKS erfasst alle polizeilich bekannten Straftaten und dient als wichtige Datenquelle zur Kriminalitätsentwicklung in Deutschland. Allerdings bildet sie nur das sogenannte "Hellfeld" ab, also die bekannt gewordenen Straftaten. Daher kann sie ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Kriminalitätslage vermitteln.
Dunkelfeldstudien: Um ein umfassenderes Bild zu erhalten, werden Dunkelfeldstudien durchgeführt, die auch nicht angezeigte Straftaten berücksichtigen. Der Niedersachsensurvey 2022 des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen befragte 8.539 Neuntklässler zu ihren Erfahrungen als Täter und Opfer. Die Ergebnisse zeigten teilweise deutliche Unterschiede zur PKS: Während die PKS einen Anstieg von Sachbeschädigungen, Raubüberfällen und Körperverletzungen verzeichnete, konnte der Survey dies nicht bestätigen; insbesondere bei Körperverletzungen zeigte sich sogar ein rückläufiger Trend.
Medienberichterstattung: Die mediale Darstellung von Jugendkriminalität kann die öffentliche Wahrnehmung stark beeinflussen. Eine Analyse der TV-Berichterstattung ergab, dass die Anzahl der Beiträge über Gewaltkriminalität ein Allzeithoch erreicht hat, wobei insbesondere ausländische Tatverdächtige und Messerdelikte im Fokus stehen. Dies steht im Gegensatz zu den tatsächlichen statistischen Daten, was zu einem verzerrten Bild in der Öffentlichkeit führen kann.
Gewalt an Schulen: Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) erleben viele Schülerinnen und Schüler psychische und körperliche Gewalt. Die Umfrage zeigt, dass sowohl psychische als auch körperliche Gewalt an Schulen präsent sind, wobei psychische Gewalt häufiger vorkommt. Lehrkräfte berichten zudem von einer Zunahme solcher Vorfälle im Vergleich zu früheren Jahren.
Fazit: Die Analyse von Bent Freiwald zeigt, dass viele Annahmen über die Zunahme von Jugendkriminalität nicht durch die Daten gedeckt sind. Vielmehr beruhen sie auf Fehlinterpretationen oder unzureichender Kontextualisierung von Statistiken. Es ist daher wichtig, sowohl Hell- als auch Dunkelfeldstudien zu berücksichtigen und die mediale Berichterstattung kritisch zu hinterfragen, um ein realistisches Bild der Jugendkriminalität zu erhalten.
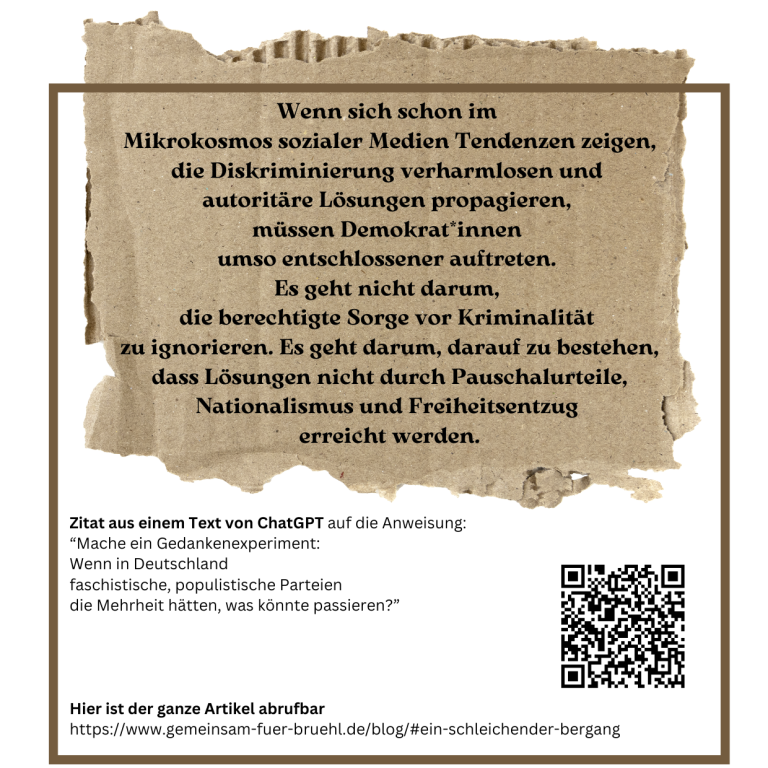
Zitate von ChatGPT
"Wenn Migrant*innen zu Sündenböcken für alle erdenklichen Probleme erklärt werden, entsteht ein Klima der Angst, in dem sich autoritäre Macht festigen kann."
"Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt, dass nationalistische Abschottung und die Schwächung internationaler Kooperationen stets ein fruchtbarer Boden für autoritäre Systeme waren."
Ein schleichender Übergang
– wie lokale Stimmungen autoritäre Politik befördern können
Könnte eine Regierung unter der AfD den Weg in den Faschismus bereiten? Diese Frage lässt sich nicht allein anhand der Programmatik einer Partei beantworten. Vielmehr erweist sich, dass sich autoritäre Strukturen nicht von heute auf morgen auf nationaler Ebene durchsetzen, sondern im Kleinen wachsen: in Nachbarschaften, Lokalszenen und Online-Diskussionen, wie sie sich beispielsweise in Brühl abspielen. Dort bilden sich in frei lesbaren Chats Stimmungen heraus, die eine gefährliche Dynamik entwickeln – aus der Sorge um Kriminalität wird allzu schnell pauschale Ausgrenzung, aus legitimer Furcht eine vereinfachte Weltsicht mit klaren Sündenböcken. Aus einer solchen Mentalität kann sich eine Haltung entwickeln, die eine autoritäre Regierungsübernahme erleichtert.
In lokalen Debatten beobachten wir, wie nach Messerangriffen oder Einbrüchen pauschale Schuldzuweisungen an „Fremde“ oder „Illegale“ lauter werden. Hier entsteht ein Klima, in dem Fakten und differenzierte Analysen als „weltfremd“ abgetan werden. Wer auf Rechtsstaatlichkeit, Ursachenforschung oder Verhältnismäßigkeit verweist, stößt auf Widerstand. Stattdessen gilt in vielen Kommentaren das Motto: Härte um jeden Preis. Abschiebungen, scharfe Kontrollen, strikte Grenzziehungen – all das wird als vermeintlich einfache Lösung angepriesen. Die Feindbilder, die sich hier manifestieren, sind Wasser auf die Mühlen all jener Kräfte, die eine autoritäre Wende anstreben.
Die AfD bedient genau diese Ressentiments, indem sie systematisch Gruppen ausgrenzt und den Nationalstaat als exklusiven Schutzraum verklärt. Ihre Forderungen reichen von massiven Einschränkungen im Asylrecht bis hin zu einer Europapolitik, die auf Abschottung und Isolation setzt. Dies ist kein bloßer Zufall, sondern ein bewährtes Muster: Autoritäre Bewegungen gründen ihre Macht stets auf ein Fundament aus Angst, Abgrenzung und Feindbildern. Dabei ist die Geschichte eindeutig: Nationalistische Politik, wissenschaftliche Ignoranz, der Rückzug aus internationalen Kooperationen und die schrittweise Beschneidung bürgerlicher Freiheiten sind Merkmale, die jene Pfade säumen, die in autoritäre Systeme münden.
Der Weg dorthin ist selten ein offener Staatsstreich. Vielmehr ereignet er sich schleichend. Schon bevor eine Partei wie die AfD in Regierungsverantwortung kommt, können sich autoritäre Denkmuster normalisieren – etwa durch Debatten, die gewaltsame Konflikte reflexhaft mit „Fremden“ verknüpfen und „härtere Maßnahmen“ fordern, ohne Ursachen oder Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Eine solche Atmosphäre ist fruchtbarer Boden für extreme politische Konzepte, weil sie die Bevölkerung an ein krudes Freund-Feind-Denken gewöhnt und die Bereitschaft stärkt, Rechte einzuschränken, wenn nur „die Bedrohung eingedämmt“ wird.
Dies zeigt, dass die Auseinandersetzung mit autoritären Tendenzen nicht erst an der Wahlurne beginnt. Sie findet schon dort statt, wo Menschen ihr Unbehagen äußern, wo Kommentare verfasst, Meinungen geäußert und Stimmungen geschürt werden. Der Ton in den Chats und Foren ist dabei kein harmloses Hintergrundrauschen, sondern ein Frühindikator. Je verbreiteter es wird, Minderheiten pauschal zu verdächtigen, desto leichter ist es für Parteien mit autoritärem Profil, sich als „Kümmerer“ darzustellen – und dabei demokratische Grundwerte Schritt für Schritt auszuhöhlen.
Die Lehren der Geschichte sind klar: Demokratien sterben leise. Sie werden nicht plötzlich abgeschafft, sondern langsam und Stück für Stück von innen heraus erodiert. Was als Kampf gegen Kriminalität oder „Kulturfremdes“ daherkommt, kann schnell zur Rechtfertigung werden, zentrale Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde zu untergraben. Heute noch scheinbar radikal, können solche Positionen morgen bereits gesellschaftlich akzeptiert erscheinen, wenn es gelingt, ein Klima der Angst und Abschottung zu etablieren.
Angesichts dieser Entwicklungen ist Wachsamkeit gefragt. Wenn sich schon im Mikrokosmos sozialer Medien Tendenzen zeigen, die Diskriminierung verharmlosen und autoritäre Lösungen propagieren, müssen Demokrat*innen umso entschlossener auftreten. Es geht nicht darum, die berechtigte Sorge vor Kriminalität zu ignorieren. Es geht darum, darauf zu bestehen, dass Lösungen nicht durch Pauschalurteile, Nationalismus und Freiheitsentzug erreicht werden.
Die Verteidigung der Demokratie beginnt im Kleinen: in der Auseinandersetzung mit diffusen Ängsten, im Beharren auf Fakten, im Widersprechen, wenn Menschen pauschal ausgegrenzt werden. Hier liegt die Verantwortung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Denn Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie braucht ihren Rückhalt in der Zivilgesellschaft – und die Bereitschaft, für Prinzipien wie Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsvielfalt einzutreten. Tut man dies nicht rechtzeitig, droht, dass allmählich jene freiheitlichen Fundamente ins Wanken geraten, die ein Zusammenleben in Vielfalt und Sicherheit überhaupt erst ermöglichen.
Hinweis
Der Text ist KI-generiert und damit copyrightfrei - er basiert auf Chatausschnitten einer Brühler Facebookgruppe und folgender Quellen
https://taz.de/Faschismus-in-Europa/!5887063/
https://www.nzz.ch/feuilleton/faschismus-paul-mason-beschreibt-wie-er-zu-stoppen-waere-ld.1687479
https://www.freitag.de/autoren/tadzio-mueller/rechtsruck-in-deutschland-warum-reden-alle-ueber-migration
https://www.riffreporter.de/de/international/faschismus-demokratie-regierung-wahlen-geschichte-politik-usa-praesident-trump
https://archive.org/details/ArmyTalkOrientationFactSheet64-Fascism/mode/2up?view=theater
https://www.pw-portal.de/demokratie-und-frieden/ueberblick/jason-stanley-wie-faschismus-funktioniert
https://www.deutschlandfunk.de/buch-erscheint-in-deutschland-madeleine-albright-warnt-vor-100.html
Entwurf des Wahlprogramms der AfD zur Bundestagswahl 2025 (wird hier nicht verlinkt)
Messerangriffe: „Ich fühl mich nicht mehr sicher, es muss etwas getan werden. Aber was?“
Kommentar zu Messerattacken in Brühl
10.12.2024
Alle, die gegen Messerattacken sind, können hier einen Daumen hoch, einen Smiley oder sonstwas hinterlassen! Na, traut ihr euch, dagegen zu stimmen? Nein, wer mag schon Messer außerhalb der Küche und der Kunst?
Man fühlt sich nicht mehr sicher – und das in einer kleinen Mittelstadt wie Brühl. Daumen hoch, falls ihr euch heute auch unsicherer fühlt!
“Populisten und Faschisten »framen« und »performen« Krisen geradezu, da sie die Krise brauchen, um sich als Retter (der Nation, des Abendlandes, des Volkes usw.) zu inszenieren” - heißt es in der aktuellen Autoritarismusstudie.
Aber überlassen wir ihnen beim Angst-Erzeugen und Spalten einfach so das Feld? Framen bedeutet “meist korrekte Sachverhalte im falschen Rahmen darstellen” - Gewalttaten gibt es, aber was sind die Ursachen, wer sind die Täter und was können wir tun?
Populisten nutzen Ängste und Sorgen - soziale Medien können sie verstärlen, können Echokammern werden, in denen man Bestätigung findet - und sei es auch nur für Vorurteile.
Aber kommen wir zurück zu den Messertaten.
Früher war das doch anders, so der Tenor, der durch soziale Medien, Stammtische und Familiengespräche hallt. Damals konnte man durch Parks spazieren, mit der Linie 18 fahren oder in Unterführungen und dunklen Gassen verweilen. Seit wann hat sich das geändert? Seit 2015? Seit der Einführung des Euros? Seit Merkel? Sind wieder die Grünen irgendwie schuld?
Es ist schwer, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, aber eines steht fest: Das Sicherheitsgefühl wird durch eine Messerattacke nach der anderen erschüttert. Die da oben lassen uns damit allein, sie reden es sogar noch schön oder relativieren. Die Empörung wächst. Doch niemand möchte in die rechte Ecke gedrängt werden, nur weil man Angst hat, in der Bahn zu sitzen – neben Menschen, die so aussehen, als hätten sie ein Messer griffbereit in der Tasche. Im besten Fall wollen sie nur Geld oder Smartphones.
So weit ist es gekommen: Misstrauen und Spaltung beherrschen die Debatte. Die da oben, wir potenziellen Opfer, die anderen, die so aussehen, als gehörten sie zur Tätergruppe, die wir uns in der populistischen Schublade zurechtgelegt haben. Es sind nicht die Integrierten, die schon lange in der Nachbarschaft leben – es sind die anderen, die weg sollen, damit wir wieder angstfrei durch die Stadt ziehen können. Wir aus der Gruppe der Richtigen und sie aus der Gruppe der Falschen. Was haben sie überhaupt hier zu suchen?
Die sozialen Medien verstärken diesen Ruf: „Die Anderen müssen weg! Ohne sie war es besser!“ Abschieben, wegsperren – es wird doch noch erlaubt sein, das zu fordern, ohne gleich in die rechte Ecke gedrängt zu werden! Diejenigen, die inzwischen wählbar sind und als „rechts“ bezeichnet werden, tun zumindest etwas.
Die AfD stellt beispielsweise Anfragen im Stadtrat, legt den Finger in die Wunde: Was tut die Politik dagegen? Wie schützt sie uns vor den Tätern?
Zeit für eine sachliche Analyse.
Gewaltdelikte nehmen zu, während die Kriminalität im Langzeittrend zurückgeht. Schönreden hilft nicht: Gewalt ist schlimm und erzeugt Opfer. Aber wer sind die Täter?
Mehr als 90 % der Täter von Gewaltdelikten sind männlich, fast die Hälfte unter 20 Jahre alt. Auch der Faktor „ausländisch“ taucht überproportional auf. Allerdings wird deutlich, dass Risikofaktoren wie geringe Bildung, Armut, junges Alter, Gewalterfahrung und Traumata entscheidender sind als Herkunft – Faktoren, in die Menschen ohne deutschen Pass ebenfalls oft gelten, aber nicht wegen ihrer Herkunft.
Geringe Bildung, Armut und junges Alter gab es auch vor den Zuwanderungswellen.
Das Rollenbild von Männlichkeit spielt ebenfalls eine große Rolle: „Ich muss Stärke zeigen.“ Diese Einstellung wird vorgelebt, anerzogen und von Gleichaltrigen übernommen.
Waffen sind dabei ein Statussymbol. Messer sind leicht zu beschaffen, günstig und vermeintlich „cool“. Je nach Umfrage trägt inzwischen jeder dritte junge Mann in der Freizeit ein Messer bei sich - das Messer hat einfach Einzug in den Alltag genommen.
Wie kann die Gesellschaft reagieren?
Höhere Strafen helfen kaum, denn während der Tat denkt niemand über Strafen nach. Ein Ansatz könnte ein Verbot bestimmter Messerarten sein, um Polizeikontrollen zu ermöglichen. Solche Kontrollen schaffen Unsicherheitsgefühle bei Messerträgern: „Ich könnte erwischt werden.“
Die Lösung bleibt schwach: Ein Verbot allein bewirkt wenig. Die Gesellschaft muss an der Einstellung arbeiten: Gewalt und Waffen dürfen nicht als „cool“ gelten.
Messer müssen in der Wahrnehmung junger Menschen ihren Status als Symbol von Stärke verlieren. Kriminologe Dirk Baier schlägt vor, Messer als Zeichen von Schwäche darzustellen: „Nicht als cool und stark soll das Messer gelten, sondern als Versagermerkmal.“ Jugendliche unterschätzen oft die Gefahr von Messern – nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst.
„Wer sing Messer bruch, kütt flöck noh Klingelpöötz.“
Der juristische Unterschied zwischen Faustschlägen und Messerangriffen ist gravierend: Ein Messer macht aus einer einfachen Körperverletzung schnell eine gefährliche Körperverletzung oder sogar versuchten Totschlag. Die Aufklärungsquote von Messergewalttaten liegt bei 70 %, ein Täter wird also meist belangt.
In sozialen Medien wird oft pauschal Abschiebung gefordert, stillschweigend wird vorausgesetzt, dass Täter abgeschoben werden können. Doch die Realität sieht anders aus: Viele Täter haben deutsche Vornamen, deutsche Pässe. Eine Anfrage der AfD-Saarland zeigte 2019, dass Namen wie Michael, Daniel oder Andreas häufiger vorkamen als syrische oder afghanische Namen. Christian, Nico, Ali waren in Berlin die häufigsten Vornamen von Berliner Messer-Angreifern im Jahr 2022. Michael, Chistian und Nico, wie soll ich die denn erkennen? Auch Deutsche gehören einfach zu den Risikogruppen, aus denen die Täter meist stammen: geringe Bildung, Armut, junges Alter, Gewalterfahrung und Traumata, Drogenkonsum. Aber sie passen nicht in das Muster, die über die sozialen Medien verbreitet werden, die populitisch genutzt werden. Wie soll man Michael abschieben?
Das gesellschaftliche Ziel muss ein anderes sein: Jugendliche sollen erkennen: „Nur wer sich schwach fühlt, greift zu einem Messer.“ Die Vorstellung, dass ein Messer einen Mann stark macht, muss ersetzt werden durch das Ideal, dass wahre Stärke im Verzicht auf Gewalt liegt. Die coolsten Jungs haben weder Messer noch Fäuste nötig.
Diese kulturelle Änderung ist keine schnelle Lösung, aber die einzige nachhaltige. Kampagnen wie in der Schweiz („Dinni Muetter wott dich nöd im Knascht bsueche“) könnten Vorbilder sein. Auch in Deutschland müsste eine solche Haltung durch Schulen, Jugendarbeit und Medien verbreitet werden. Jugendliche sollten lernen, dass sie nicht als Opfer, sondern als echte Verlierer enden, wenn sie zum Messer greifen.
Was nützen in dieser Debatte Stammtischparolen und Spaltung? Angst lässt sich durch gegenseitiges Misstrauen nicht verringern. Die Lösung liegt in der Arbeit an den Ursachen – nicht in Vorurteilen. Dazu muss die Mehrheit zusammenrücken und stark sein - wir wollen uns nicht spalten lassen!
Der Text ist KI-generiert und damit komplett copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.
Quellenauswahl
Der Artikel basiert auf diesen und weiteren Quellen (siehe auch die folgenden beiden Blogartikel).
Wer sich informieren möchte, kann z.B. hiermit anfangen.
Die AfD fragt, welche Vornamen Messer-Angreifer haben
Namen von Messertätern im Saarland 2019 / Berlin 2021/22 https://www.welt.de/politik/deutschland/article191024189/Messerattacken-Die-AfD-erfragt-Vornamen-der-Angreifer.html
und
https://www.bz-berlin.de/berlin/messer-angreifer-heissen-haeufig-oft-christian
“Messerangriffe in Deutschland: "Gesetze werden das Problem nicht lösen" - 26. August 2024 - Es sind die Lebenslagen als Nationalität
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/messerangriffe-statistik-taeter-nationalitaet-bedeutung-kriminologe-102.html
„Das Springmesser ist für Jugendliche ein Statussymbol“ 06.2024 - https://www.welt.de/politik/video252029716/Messerattacke-Mannheim-Das-Springmesser-ist-fuer-Jugendliche-ein-Statussymbol.html
Messer im Jugendalltag - Neue Befunde aus Schülerbefragungen, Baier, Bergmann, Kiem 2018
Audio
Haben wir wegen der ständigen Berichte zu viel Angst vor Verbrechen?
Ab 13 min zu Messerstechern
https://uebermedien.de/?p=100323
IQ - Wissenschaft und Forschung: Wird alles immer schlimmer? Wie wir Vergangenheit und Gegewart wahnehmen
Thema Kriminalität 6:16 min
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-8-oktober-2024-100.html
ab 13 min - Satire über Kriminalstatistik und gefühlte Kriminalität
Kriminologische Studie: Viele Jugendliche haben Messer zur Verteidigung dabei
Populisten
Aus der Autoritarismusstudie, Kapiel: Fazit: Wahrgenommene Deprivation ausschlaggebend
Es herrscht eine aggressivere Grundstimmung
Dirk Baier: «Es herrscht eine aggressivere Grundstimmung»
Mehr schwere Gewalt, mehr Diebstähle: Die neusten Zahlen zur Kriminalität in der Schweiz beunruhigen die Behörden. Kriminologe Dirk Baier ordnet ein.
In der Schweiz sind laut der neusten Kriminalstatistik des Bundes im vergangenen Jahr mehr Straftaten registriert worden. Besonders schwere Gewalttaten und Diebstähle verzeichneten neue Höchstwerte. Ein deutlicher Anstieg wurde zudem bei der digitalen Kriminalität verzeichnet – mit einem Plus von über 30 Prozent. Wird unsere Gesellschaft gewaltbereiter?
Dirk Baier ist Kriminologe an der Universität Zürich und leitet zudem das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
25.03.2024
bei 24:20 min - was kann man machen?
https://www.srf.ch/audio/tagesgespraech/dirk-baier-es-herrscht-eine-aggressivere-grundstimmung?id=0c953911-73d6-48d0-a8b4-eef5e255c2b6#
Messergewalt verhindern: "Keine etablierten Konzepte"
WDR 5 Morgenecho - Interview. 09.08.2024
"Nach einer Reihe von Messerangriffen werden die Rufe nach einem schärferen Waffenrecht lauter. "Wir müssen im Jugendalltag eine Art Kulturveränderung hervorrufen", fordert Kriminologe Dirk Baier dagegen. Besonders Gleichaltrige seien dabei gefordert."
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/messergewalt-verhindern-keine-etablierten-konzepte-100.html
Experte zu Messergewalt: Prävention stärken 12.08.2024
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/messer-attacken-zunahme-kriminologe-praevention-100.html
Kriminalstatistik: Zerrbild vermeiden 10.04.2024
WDR 5 Morgenecho - Interview.
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-kriminalstatistik-zerrbild-vermeiden-100.html
Wird alles immer schlimmer? Wie wir Vergangenheit und Gegewart wahrnehmen
IQ - Wissenschaft und Forschung: Wird alles immer schlimmer? Wie wir Vergangenheit und Gegewart wahnehmen
Pocken oder Pest sind ausgerottet, die Lebenserwartung hat sich in Deutschland in den vergangenen 150 Jahren verdoppelt. Dennoch sind viele davon überzeugt: Alles wird immer schlimmer. Woran liegt es, dass die Vergangenheit so rosig, die Gegenwart so düster erscheint?
Webseite der Episode: https://www.br.de/mediathek/podcast/iq-wissenschaft-und-forschung/wird-alles-immer-schlimmer-wie-wir-vergangenheit-und-gegewart-wahnehmen/2099940
Mediendatei: https://media.neuland.br.de/file/2099940/c/feed/wird-alles-immer-schlimmer-wie-wir-vergangenheit-und-gegewart-wahnehmen.mp3
Kriminalität: 6:16 min
Umfrage Kriminalität nimmt zu/ab/weder noch
Gefühlte Kriminalität: Antworten auf: Hat in den letzten 5 Jahren die Kriminalität zugenommen? Ja, hat zugenommen.
Aber bereits vor 10 und 15 Jahren ähnlich.
Kiminalitätsfurcht passt nicht zu realem Risiko. An den meisten Plätzen ist das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, sehr gering. Der Mensch ist schlecht darin, Risiken einzuschätzen.
Tu was!
Buch : Tu was!
https://www.chbeck.de/polenz-tu-was_/product/37037751
Ruprecht Polenz im DAS!-Interview
Worum geht's?
Demokratie ist kein Selbstläufer – das macht Ruprecht Polenz in seinem neuen Buch unmissverständlich klar. Mit klaren Worten und praktischen Tipps zeigt er, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, unsere Freiheit und Vielfalt zu bewahren. Egal ob durch Diskussion, Engagement oder klare Haltung: Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden! Erfahre in unserem Artikel, warum Polenz’ Botschaft gerade heute so wichtig ist und wie auch du einen Unterschied machen kannst.

Leipziger Autoritarismus Studie 2024
Vereint im Ressentiment
Autoritäre Dynamiken
und rechtsextreme Einstellungen
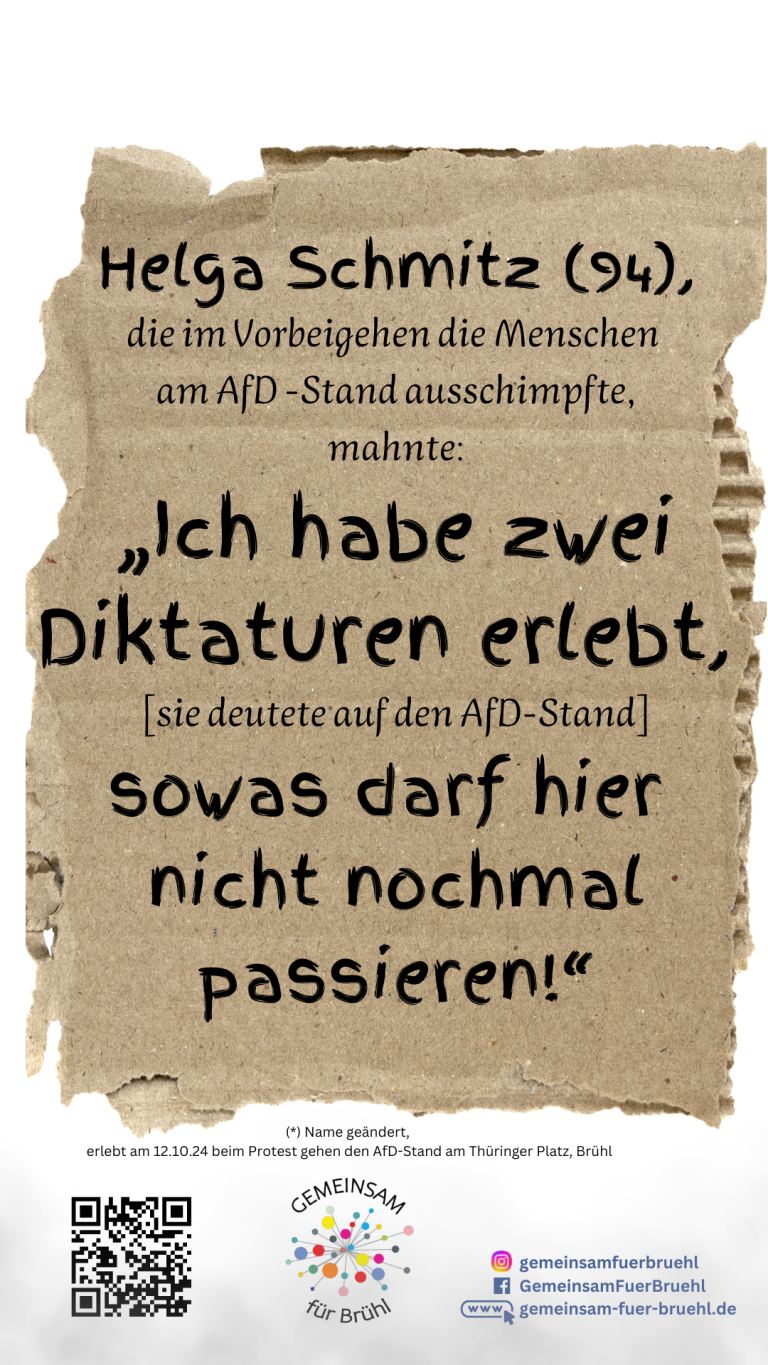
Zwei Diktaturen
Beim Protest gegen den AfD-Stand am Thüringer Platz am 12.10.24 kam es zu der Gegebenheit, die auf dem Schild beschrieben wurde.
Wir dürfen nicht vergessen.
Nie wieder ist jetzt!
Oskar Schindler würde Sie verachten - Friedmann in einer Rede zu Oskar Schildler über die AfD
Michel Friedmans Rede im Wiesbadener Landtag am 50. Todestag von Oskar Schindler sorgte für Aufsehen, insbesondere durch seine scharfe Kritik an der AfD. Während die übrigen Abgeordneten seine Worte mit stehenden Ovationen würdigten, verharrte die AfD in demonstrativer Ablehnung. Friedman betonte in seiner Rede die Gefahren von Hass und Hetze und stellte die AfD als „Partei des Hasses“ dar. Ohne die Partei namentlich zu erwähnen, sprach er von „geistigen Brandstiftern“, die vorgäben, im Interesse des Volkes zu handeln, tatsächlich aber gegen die Menschen arbeiteten.
Er erklärte, dass Mitglieder dieser Partei zwar gewählt seien, aber keine Demokraten, da sie die Grundidee verletzten, dass jeder Mensch von gleichem Wert ist. Friedman betonte, dass einige der anwesenden Abgeordneten sich anmaßten, zu bestimmen, wer ein Mensch oder Deutscher sei. Er schäme sich, in einem Parlament zu sprechen, das Menschen beherberge, die die Demokratie zerstören wollten, während sie vorgäben, im Interesse der Bevölkerung zu handeln.
Friedman hob die Heuchelei und Doppelmoral dieser Politiker hervor, die in Wahrheit nicht für, sondern gegen Menschen arbeiteten. Er äußerte, dass Oskar Schindler die AfD verachten würde und ging auf die Tatsache ein, dass Juden in Deutschland überlegen müssten, das Land zu verlassen, was er als Offenbarung der gesellschaftlichen Missstände betrachtete.
Er warnte davor, dass der Hass der AfD nicht nur Juden, sondern letztlich alle treffen würde. Schließlich stellte Friedman klar, dass jeder Mensch in einer Demokratie gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können müsse, unabhängig davon, welche Partei versuche, bestimmte Gruppen zu marginalisieren.
Friedman hob Schindler als Vorbild in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Spaltung hervor und appellierte an die Notwendigkeit des Handelns. Seine Worte, dass Schindler die AfD „verachten“ würde, rüttelten an den Grundwerten der Demokratie und forderten aktiven Widerstand gegen Rassismus und Antisemitismus. Friedmans scharfe Kritik richtete sich zudem gegen Linksextremisten und Islamisten, die ebenfalls eine Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland darstellten.
Rede in voller Länge
Weitere Links
- https://www.hessenschau.de/politik/landtag/oskar-schindler-wuerde-sie-verachten-wie-michel-friedman-mit-der-afd-abrechnete-v3,friedman-rede-landtag-afd-100.html
- https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-oskar-schindler-wuerde-sie-verachten-wie-michel-friedman-im-landtag-mit-der-afd-abrechnete-100.html
- https://www.stern.de/panorama/michel-friedman-attackiert-afd-in-rede---deren-provokation-verpufft-35132830.html
Meldeseite gegen Hetze
Absurd, über einen Twitterbeitrag von Frau von Storch bin ich auf folgende Seite gestoßen, auf der man Hetze im Netz melden kann. Frau von Storch hetzt aus meiner Sicht selbst gegen diese Seite und fordert auf, sie zu fluten - "mit Hass und Hetze von Links". Auf eher linken Seiten wird ihr Zitat genutzt, um auf die Meldeseite nun aufmerksam zu machen.
Erreicht hat das alles zumindest bei mir, dass ich auf die Seite aufmerksam geworden bin und die Meldestelle gut finde.
meldestelle-respect.de richtet sich vonehmlich an Jugendliche, scheint aber nicht ausschließlich diese Zielgruppe zu behandeln.
Hier noch der Kommentar von Frau von Storch über Twitter, den man bei google findet, den ich hier aber nicht verlinke:
Sie schreibt: "Ganz offiziell: In [Deutschlandfahne] ist der Blockwart zurück! Offenbar sogar staatlich finanziert. Hier der Link der offiziell zugelassenen #Meldestelle. Bitte FLUTET diese Seite mit Hass, Hetze, Beleidigungen usw VON LINKS!"
Ob von Storchs Beitrag selbst bereits meldenswert wäre, lässt sich diskutieren. Auf jeden Fall merkt man, dass sie stört, dass es eine Seite gibt, über die man einfach man Hass und Hetze melden kann. Vermutlich weiß sie, wessen Beiträge dort vor allem gemeldet werden. Sie weiß sicherlich, wer Hass und Hetze im Netz verbreitet.
Zusammenfassung, was die Meldestellenseite macht
Die Meldestelle „REspect!“ hilft bei der Meldung von Hass und Hetze im Netz. Sie bearbeitet eingegangene Meldungen, überprüft die strafrechtliche Relevanz und leitet, falls notwendig, diese an das Bundeskriminalamt weiter. Meldungen können anonym erfolgen, und es wird keine Rückmeldung erwartet, wenn keine E-Mail angegeben wird. Strafbare Inhalte wie Volksverhetzung oder Holocaustleugnung werden behandelt, während nicht alles strafrechtlich relevant ist. Nicht jede Meldung führt zur Anzeige, und manche Delikte müssen von den Betroffenen selbst gemeldet werden.
https://meldestelle-respect.de
https://meldestelle-respect.de/faq/
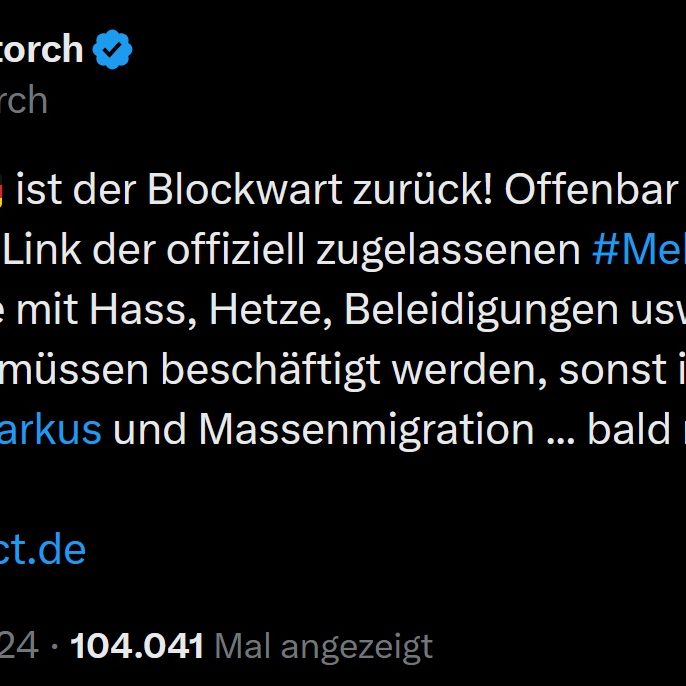

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft
Die Stadt Brühl bereitet sich aktiv auf eine klimafreundliche Zukunft vor, indem sie ihre Wärmeversorgung auf nachhaltige Energien umstellt. Aktuell wird der Großteil der Wärmeversorgung durch Erdgas gedeckt, was jedoch aufgrund steigender CO₂-Preise ab 2027 erhebliche Mehrkosten verursachen wird. Der europäische Emissionshandel, der fossile Energieträger wie Gas verteuert, könnte Haushalte mit mehreren hundert Euro zusätzlich belasten. Laut einer Studie könnten allein die Kosten für Erdgas um bis zu 160 Euro pro Tonne steigen.
Parallel dazu werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels immer spürbarer. Bis 2050 könnten die Kosten durch Extremwetterereignisse in Deutschland bis zu 900 Milliarden Euro betragen. Um dieser finanziellen Belastung entgegenzuwirken, sind Maßnahmen wie Gebäudesanierungen und der Umstieg auf erneuerbare Energien, wie Wärmepumpen, unerlässlich. In Brühl wird bereits intensiv an der Integration von Wärmepumpen gearbeitet – 62 % der Gebäude eignen sich dafür, was Einsparungen von bis zu 200 GWh pro Jahr bedeuten könnte.
Die Nutzung erneuerbarer Energien wird langfristig eine ökonomische Notwendigkeit, da die CO₂-Bepreisung und die politischen Klimaziele Gas als Energieträger immer teurer machen werden. Die Einführung von Technologien wie Wärmepumpen und Fernwärmenetzen wird nicht nur ökologisch sinnvoll sein, sondern auch die Heizkosten für die Bürger reduzieren.
Brühl hat den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung bereits angestoßen. Die internationale Entwicklung zeigt, dass Wärmepumpen eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen, wie die Beispiele aus Norwegen, Schweden und Frankreich belegen. Deutschland steht zwar noch am Anfang, doch Brühl kann durch kluge Planung und nachhaltige Investitionen früh genug die Hausaufgaben in Richtung Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit machen.
Links
Eine ausführliche Version dieses Artikels erschien unter
https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/bruehl/c-nachrichten/auf-dem-weg-in-eine-nachhaltige-zukunft_a325987
https://www.bruehl.de/kommunale-waermeplanung.aspx
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/WPG/WPG-node.html
Gereinigt und niemals vergessen
Siegmund Selig Sürth, sein Gedenkstein ist der erste der drei verschmutzen, hatte sich sein Leben sicherlich anders vorgestellt.
Er wurde mit 42 Jahren ins Vernichtungslager Maly Trostinez deportiert und wurde dort getötet.
Ein Überlebender aus Wien schilderte das Leben dort, wir müssen befürchten, dass es Siegmund Sürth ebenso erging:
"Bis Wolkowisk fuhren wir in Personenzügen. Dort mussten wir bei gänzlich verdunkeltem Bahnhof, mitten in der Nacht den Zug verlassen und in Viehwaggon umsteigen. Viele, die sich nicht so schnell zurechtfinden konnten[,] bekamen die Stiefel der SS zu spüren, und alte Gebrechliche blieben unter den Knüppelschlägen auf dem Bahnsteig liegen. – In dieser Nacht hatten viele den Verstand verloren – waren irrsinnig geworden. Die Transportleitung gab den Auftrag sämtliche irrsinnig Gewordene in einen separaten Waggon zu sperren. Was sich in diesem Waggon abspielte ist nahezu unbeschreiblich."
Den Gedenkstein zu beschmutzen ist unwürdig. Er ist ein Mahnmal an die Qual, die aus fanatisch-politischen Gründen von Deutschland ausging. Nie wieder!
Links
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de980395
https://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungslager_Maly_Trostinez
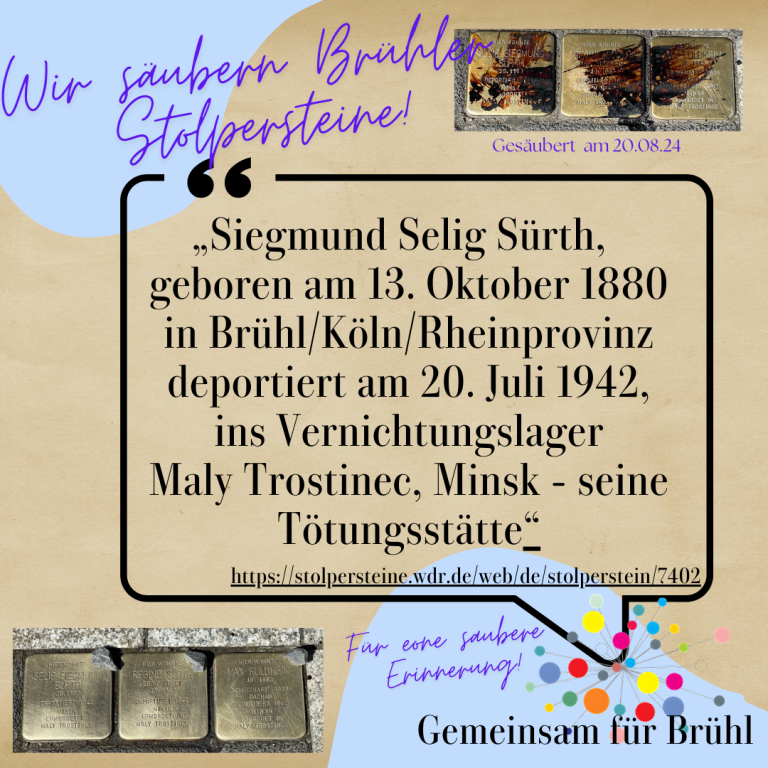
Die gute Nachricht: Brühl treibt den Ausbau von Photovoltaikanlagen erfolgreich voran
Brühl, 31.07.24
Liest man in sozialen Medien über Brühl, so erhält man mitunter den Eindruck, dass vieles nicht gelingt und es in Brühl überall den Bach ‘runter geht. An diesen Artikeln und den Kommentator*innen können wir wenig ändern, aber wir können die Kehrseite darstellen: Was läuft denn in Brühl und warum ist es eine angenehme und zukunftsorientierte Stadt.
Dieses Vorwort wird Markenzeichen einer kleinen Artikelserie, die unregelmäßig erscheint.
Die Nutzung von Solarstrom spielt eine zentrale Rolle in der deutschen Energiewende und gewinnt auch in Brühl zunehmend an Bedeutung. Aufgrund der erheblich gesunkenen Kosten für Solaranlagen und Solarspeicher wird Solarenergie für Hausbesitzer und Unternehmen immer attraktiver. Das Fraunhofer-Institut fasst zusammen: "Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sind die Preise für PV-Module um 90 % gesunken. Auf lange Sicht wird erwartet, dass die Modulpreise [...] weiter sinken."
Und wenn die Sonne nicht scheint? Seit 2010 sind die Preise für Speicher um 85 % gesunken, von ca. 6.000 Euro auf knapp 1.000 Euro pro Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität (Stand: Februar 2024). Diese Entwicklung ermöglicht es, den erzeugten Solarstrom auch nachts und bei bewölktem Wetter zu nutzen.
Und die vieldiskutierte Atomkraft? Dazu berichtet Capital.de: "der Wegfall der Kernkraft in Deutschland [konnte] gut kompensiert werden [...]. Entgegen den Behauptungen liege der Anstieg beim Import nicht an mangelnden Erzeugungskapazitäten in Deutschland, sondern an den günstigen Erzeugungspreisen der erneuerbaren Kraftwerke in den Alpen und in Skandinavien."
Brühl setzt verstärkt auf Solarenergie, um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 wurden Anlagen mit einer Gesamtleistung von 240 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. Weitere 260 kWp sind in der Errichtungsphase und sollen noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Ein Beispiel für die innovativen Projekte ist die kürzlich realisierte Photovoltaikanlage an der Mauer des Schießstandes an der Bonnstraße, die jährlich knapp 10 Tonnen CO₂ einspart.
Die Stadt hat auch zahlreiche PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden installiert, darunter:
- Gesamtschule Glaspyramide: 5 kWp
- Lagerhalle SSB: 31 kWp
- Regenbogenschule Vochem: 30 kWp
- Kita Pehle: 30 kWp
- Turnhalle Heide: 25 kWp
- Erich-Kästner-Realschule: 45 kWp
- Gesamtschule, Turnhalle: 100 kWp
- Komm-Mit: 10 kWp
- Turnhalle Vochem: 30 kWp
- Kita An der Eckdorfer Mühle: 29 kWp
- Clemens August-Forum: 66 kWp
Aktuelle Projekte umfassen unter anderem:
- Kinder- und Familienzentrum: 45 kWp, 45.000 kWh/a, CO₂-Einsparung: 18,9 t/a
- Klärwerk Stadt Brühl: 198 kWp, 198.000 kWh/a, CO₂-Einsparung: 83,2 t/a
- Schießstand: 23,2 kWp (Fassaden-PV), 23.200 kWh/a, CO₂-Einsparung: 9,7 t/a
Zusätzlich profitieren Bürger von Brühl vom kreiseigenen Förderprogramm, das trotz ausgeschöpfter Mittel zeigt, wie groß das Interesse und der Erfolg solcher Maßnahmen sind. Besonders durch sogenannte Balkonkraftwerke können Bürger aktiv an der Energiewende teilnehmen. Diese kleinen Photovoltaikanlagen, die auf Balkonen installiert werden können, ermöglichen es den Bewohnern, ihren eigenen Strom zu erzeugen und zu nutzen. Durch den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms amortisieren sich die Kosten für Balkonkraftwerke relativ schnell über die Einsparungen bei den Stromkosten.
Eine mögliche Zukunftsvision für Brühl umfasst die umfassende Nutzung aller verfügbaren Flachdächer städtischer Gebäude für Photovoltaikanlagen. Solche Projekte würden nicht nur den Eigenbedarf der Gebäude decken, sondern auch überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einspeisen, was erhebliche Mengen an CO₂-Emissionen einsparen und die Stromkosten der Stadt senken würde.
Brühl setzt damit ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und zeigt, dass innovative Ansätze wie Fassaden-PV und kombinierte Anlagen mit Batteriespeichern erfolgreich umgesetzt werden können. Diese Projekte sind bedeutende Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität und dienen als Vorbild für andere Kommunen.
Für weitere Details und aktuelle Projekte besuchen Sie die folgenden Webseiten:
- https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
- https://www.capital.de/wirtschaft-politik/strom-und-energie--ein-jahr-ohne-atom--wie-ist-die-bilanz-des-ausstiegs--34628736.html
- Radio Erft: Brühl mit Solarstrom zur Klimaneutralität
- Radio Erft: Rhein-Erft: Fördergelder für Balkonkraftwerke und Co weg
- Stadt Brühl: Stadt Brühl geht neue Wege beim Ausbau von Photovoltaikanlagen
- https://www.bruehl.de/photovoltaik.aspx
- GEBAUSIE: Installation einer Solaranlage auf dem Balkon
- https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Germany
- https://www.fr.de/politik/energiewende-solarstrom-anlagen-einfamilien-haus-amortisierung-dauer-preis-entwicklung-93071410.html
- https://www.radioerft.de/artikel/bruehl-pv-anlage-fuer-rathausanbau-ist-nicht-ganz-vom-tisch-1444909.html
- https://sveasolar.de/de-de/blog/preisentwicklung-photovoltaik
Text: Blog-Team
Bild: KI

Wir reinigen Stolpersteine
24.06.24
Am 21. Juni entdeckte Bernd W. vor dem Reisebüro gegenüber der Giesler-Galerie in Brühl einen beschmierten Stolperstein, der an den jüdischen Kaufmann Albert Platz erinnert. Platz wurde 1942 von den Nationalsozialisten ermordet. Diese Art von Schändung ist in Brühl nicht neu; regelmäßig werden Stolpersteine beschmutzt und entehrt. Im Jahr 2023 wurden in Brühl mehrere solcher Vorfälle registriert, darunter antisemitische Schmierereien und Zahlencodes, die rechtsextreme Botschaften darstellen.
Der Jahresbericht 2023 der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) zeigt eine Zunahme antisemitischer Vorfälle in NRW um 152 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Brühl wird im Bericht besonders erwähnt, was wahrscheinlich auch auf konsequente Meldungen dieser Vorfälle an Polizei und Verfassungsschutz zurückzuführen ist.
Den ganzen Artikel gibt es hier, im Digitalteil des Brühler Schlossboten.

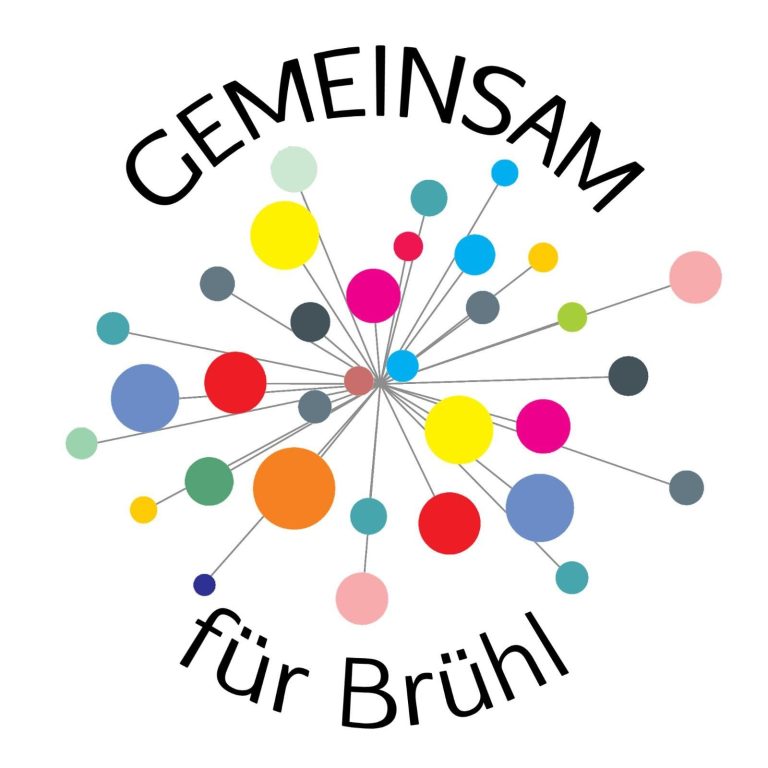
Gemeinsam für Brühl
Gemeinsam für Brühl: Ein Zeichen für Solidarität, Respekt und Demokratie
Über uns:
Gemeinsam für Brühl (GfB) wurde 2022 auf Basis der „Brühler Erklärung“ gegründet. Als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung der „Querdenker-Bewegung“ während der Corona-Pandemie setzten wir uns das Ziel, Solidarität, Respekt und die Werte unserer demokratischen Verfassung zu fördern und zu schützen.
Unsere Ziele und Aktivitäten:
Für Solidarität:
- Wir starteten 2022 mit Mahnwachen, um unsere Unterstützung für Demokratie und Freiheit zu zeigen.
- Solidaritätskundgebungen für die Menschen in der Ukraine und im Iran folgten, um unsere Unterstützung in Zeiten der Krise zu betonen.
- Die Organisation von Dialogveranstaltungen und die Teilnahme am bundesweiten „Tag der Offenen Gesellschaft“ zielten darauf ab, eine gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.
Für Respekt:
- Seit Herbst 2022 setzten wir uns aktiv gegen rassistische und antisemitische Schmierereien in Brühl ein.
- Im Oktober 2023 organisierten wir eine Mahnwache für die unschuldigen Opfer des Nahostkonflikts.
- Im November 2023 erhielten wir den Solidaritätspreis der Stiftung Soziale Arbeit für unser Engagement.
Für Demokratie:
- Wir haben Gegenkundgebungen zur „Galerie der Aufklärung“ und zum Wahlkampf-Auftritt der AfD organisiert.
- Teilnahme und Mitwirken an den Demonstrationen, „Demokratie schützen – AfD bekämpfen“ und „Wir sind Brühl - Für Demokratie, Vielfalt und Respekt“, zogen mehrere tausend Menschen an.
- Trotz eines erschütternden Ergebnisses bei der Europawahl bleiben wir entschlossen, unsere Arbeit fortzusetzen.
Mitmachen:
Alle, die sich für Solidarität, Respekt und Demokratie engagieren möchten, sind bei uns herzlich willkommen. Unsere Aktivitäten sind vielfältig, von Mahnwachen und Demonstrationen bis hin zu Dialogveranstaltungen und kulturellen Projekten. Egal, ob Einzelperson oder Institution, jede Unterstützung zählt.
Die Brühler Erklärung:
Diese Erklärung bildet die Grundlage unseres Handelns. Sie betont die Notwendigkeit von Solidarität in Zeiten der Pandemie, den Respekt für individuelle Entscheidungen und die unbedingte Verteidigung unserer demokratischen Werte gegen jegliche Art von Extremismus.
Zusammen für eine bessere Zukunft:
Gemeinsam für Brühl steht für ein starkes Miteinander in unserer Stadt. Wir setzen uns unermüdlich für eine solidarische, respektvolle und demokratische Gesellschaft ein. Mach mit und werde Teil einer Bewegung, die Brühl und darüber hinaus positiv verändert.
Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite Gemeinsam für Brühl.
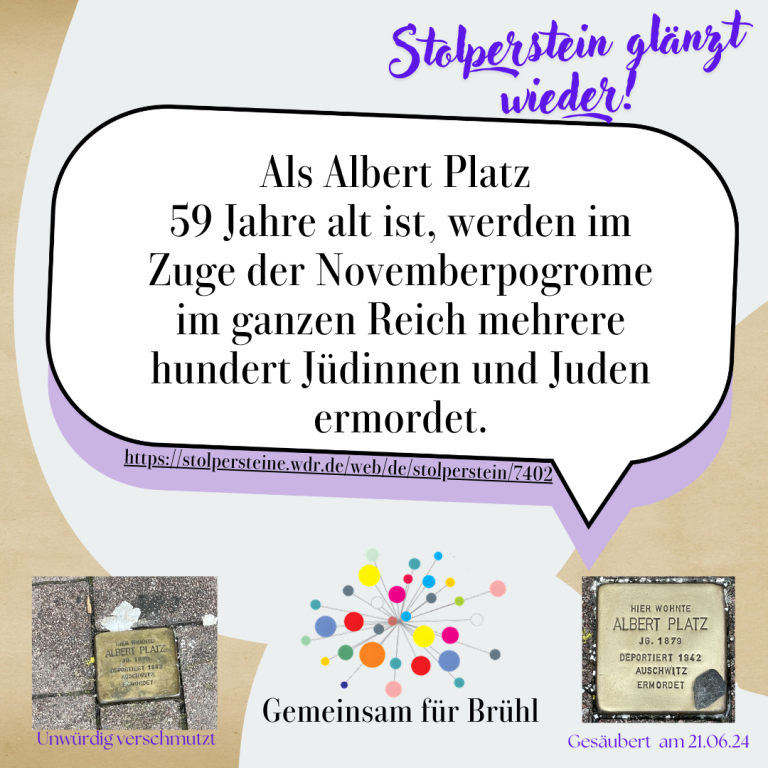
Stolperstein von Albert Platz gereinigt
21.06.24
Ein Stolperstein für Albert Platz wurde absichtlich verschmutzt. Nach der Reinigung möchten wir an ihn erinnern:
Albert Platz wurde 1879 in Lechenich geboren und war Kaufmann in Brühl. Seine erste Frau, Klara, starb 1928. Mit seiner zweiten Frau, Irma, lebte er in Mannheim. Am 22. Oktober 1940 wurden beide nach Gurs und 1942 nach Auschwitz deportiert, wo sie vermutlich ermordet wurden. 1950 wurden sie offiziell für tot erklärt.
Link
- https://www.marchivum.de/de/stolperstein/albert-platz
- https://stolpersteine.wdr.de/web/de/stolperstein/7402
Foto: Gemeinsam für Brühl
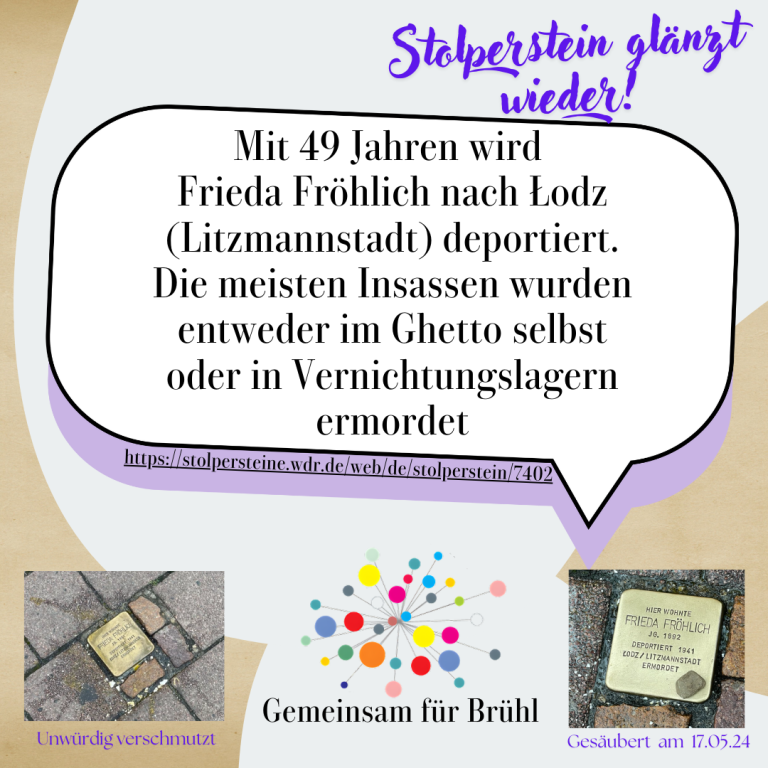
Stolperstein von Frieda Fröhlich gereinigt
17.05.24
Ein Stolperstein für Frieda Fröhlich wurde absichtlich verschmutzt. Nach der Reinigung möchten wir an sie erinnern:
Frieda Fröhlich wurde 1892 in Brühl geboren. Im Jahr 1941 wurde sie nach Łodz/Litzmannstadt deportiert und ermordet.
Frieda Fröhlich lebte vor ihrer Deportation in der Mühlenstraße 1 in Brühl. 1941 wurde sie nach Łodz deportiert, einem der größten Ghettos im von den Nationalsozialisten besetzten Polen. Dort mussten die Deportierten unter katastrophalen Bedingungen leben und Zwangsarbeit leisten. Die meisten Insassen wurden entweder im Ghetto selbst oder in Vernichtungslagern ermordet.
Leider ist nicht viel über sie bekannt, sicherlich hätte sie uns gern mehr von sich erzählt.
Für Frieda Fröhlich wurde ein Stolperstein verlegt, um an ihr Leben und ihr tragisches Schicksal zu erinnern.
Link:
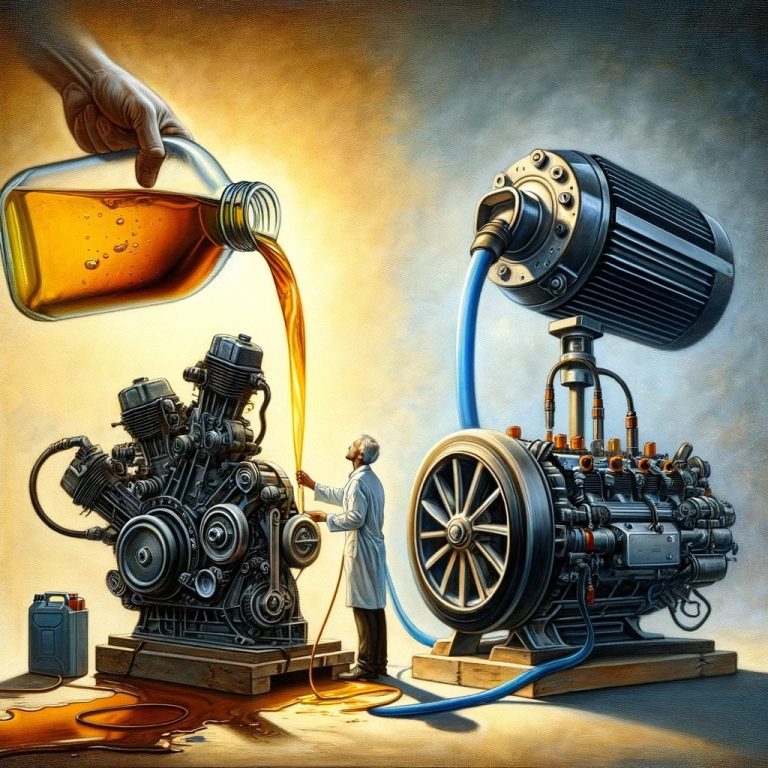
Wie Populismus funktioniert
Knallhart zusammengefasst.
https://x.com/RMogyorosy/status/1791918139334099188
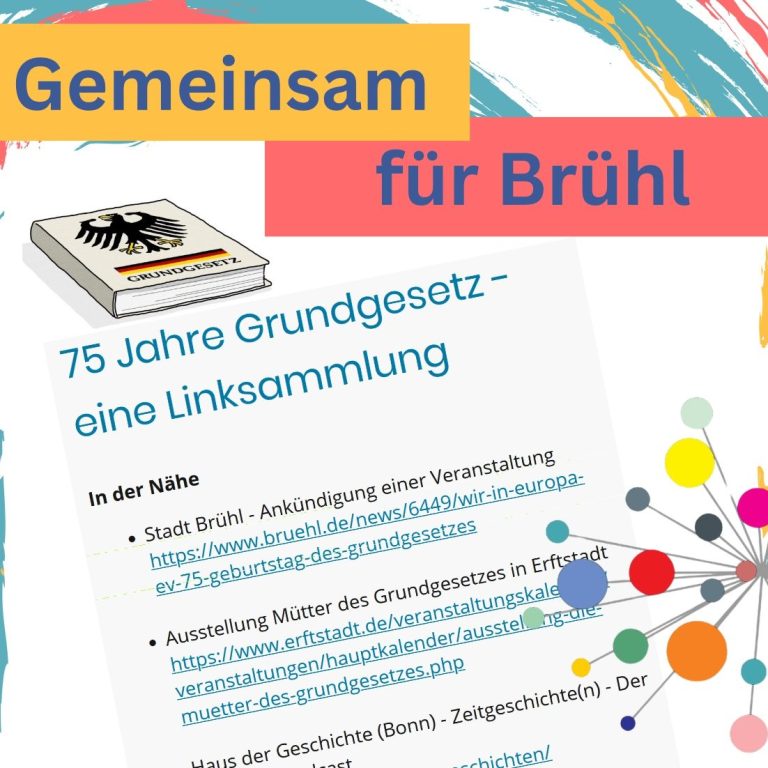
75 Jahre Grundgesetz - eine Linksammlung
In der Nähe
- Stadt Brühl - Ankündigung einer Veranstaltung
https://www.bruehl.de/news/6449/wir-in-europa-ev-75-geburtstag-des-grundgesetzes
- Ausstellung Mütter des Grundgesetzes in Erftstadt
https://www.erftstadt.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen/hauptkalender/ausstellung-die-muetter-des-grundgesetzes.php
- Haus der Geschichte (Bonn) - Zeitgeschichte(n) - Der Museumspodcast
https://podcast.hdg.de/zeitgeschichten/grundgesetz.html
Videos über einzelne Artikel
- 75 Jahre Grundgesetz: Artikel 3 - Gleichheit
- 75 Jahre Grundgesetz: Artikel 5 - Meinungsfreiheit
- 75 Jahre Grundgesetz: Artikel 16a - Asylrecht
- 75 Jahre Grundgesetz:
Wie alles angefangen hat (4 min)
Video zu den eizelnen Artikeln (je 30 min)
Serie von Alpha-Demokratie
- Artikel 1 GG · Menschenwürde
- Artikel 2 GG · Entfaltung der Persönlichkeit
- Artikel 3 GG · Alle sind vor dem Gesetz gleich
- Artikel 4 GG · Religionsfreiheit
- Artikel 5 GG · Meinungsfreiheit
- Artikel 6 GG · Ehe und Familie
- Artikel 7 GG · Schulwesen
- Artikel 8 GG · Versammlungsfreiheit
- Artikel 9 GG · Vereinigungsfreiheit
- Artikel 10 GG · Postgeheimnis
- Artikel 11 GG · Freizügigkeit
- Artikel 12 GG · Berufsfreiheit
- Artikel 13 GG · Unverletzlichkeit der Wohnung
- Artikel 14 GG · Eigentumsrecht
- Artikel 16/16a GG · Asylrecht
- Grundrechte im Wandel der Zeit
Jubiläumsseiten
- Die interaktive Seite der Bundesregierung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/75-jahre-grundgesetz
- Das Grundgesetz - Die entspannte Verfassung
https://www.deutschlandfunkkultur.de/grundgesetz-jubilaeum-100.html
- Bonn bekommt einen „Platz des Grundgesetzes“
https://www.bonn.de/pressemitteilungen/februar-2024/bonn-bekommt-einen-platz-des-grundgesetzes.php
Audio
- Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Seine Mütter und Väter haben aus der totalitären Erfahrung des 20. Jahrhunderts gelernt, sagt Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio. (11 min)
https://www.deutschlandfunk.de/75-jahre-grundgesetz-interview-udo-di-fabio-ehem-bundesverfassungsrichter-dlf-31e43555-100.html
Für Kinder
- https://www.hanisauland.de/lehrer-innen/hanisauland-material/themen_gemeinschaft-demokratie/themen-grundrechte
- Slammen über das Grundgesetz (Video)
https://www.bpb.de/mediathek/video/275218/slammen-ueber-das-grundgesetz/
Gemischte Artikel zum Thema
- Das Verfassungsjubiläum ist den meisten piepegal
https://www.n-tv.de/politik/Das-Verfassungsjubilaeum-ist-den-meisten-piepegal-article24882902.html
- Unterrichtsmaterial
https://www.zeitfuerdieschule.de/?s=grundgesetz
- Grundgesetz für Einsteiger
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Grundgesetz_fuer_Einsteiger.pdf
- Themenseite
https://www.bpb.de/themen/menschenrechte/danke-grundgesetz/
Quiz
- Quiz von Planet Schule
https://www.planet-schule.de/schwerpunkt/recht-und-gesetz/das-grundgesetz-das-grundgesetz-quiz-100.html
Video
- 75 Jahre Grundgesetz - Fundament der Demokratie
06.05.2024 ∙ unter den linden ∙ phoenix - 43 min
https://www.ardmediathek.de/video/unter-den-linden/75-jahre-grundgesetz-fundament-der-demokratie/phoenix/Y3JpZDovL3Bob2VuaXguZGUvNDQzNDcxNw
- Liebeserklärungen zum Grundgesetz (70 Jahre)
https://www.bpb.de/mediathek/video/290694/10-liebeserklaerungen-an-das-grundgesetz/
- https://www.planet-schule.de/schwerpunkt/recht-und-gesetz/das-grundgesetz-das-grundgesetz-film-100.html (inkl Skript und Kapitelübersicht)
Sammlung: Blog-Team
Bild: KI

AfD weiterhin rechtsextremer Verdachtsfall
13-05.24
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat ein klares Signal gesetzt: Die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz ist rechtens. Diese Entscheidung bestätigt frühere Urteile und lässt die Partei vorerst weiterhin unter Beobachtung stehen. "Gerichte entscheiden nicht politisch, mögen ihre Entscheidungen auch Auswirkungen auf die Politik haben", erklärte das Gericht während der Urteilsverkündung.
Die Richter befanden, dass genügend tatsächliche Anhaltspunkte vorhanden seien, die zeigen, dass die AfD Bestrebungen verfolgt, die sich gegen die Menschenwürde bestimmter Gruppen und das Demokratieprinzip richten. Besonders hervorgehoben wurde die unzulässige Diskriminierung von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund. Der Vorsitzende Richter Gerald Buck betonte die Bedeutung der wehrhaften Demokratie: "Die wehrhafte Demokratie ist kein zahnloser Tiger, aber sie beißt nur im nötigsten Fall zu."
Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang fühlte sich durch das Urteil bestätigt und würdigte die Arbeit seiner Mitarbeiter, die trotz öffentlicher Anfeindungen ihrer wichtigen Aufgabe nachgegangen sind: "Das Urteil ist ein Erfolg für den gesamten Rechtsstaat, für die Demokratie und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung", so Haldenwang.
Das Urteil hat weitreichende Implikationen: Der Verfassungsschutz darf weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen, was die Möglichkeiten der geheimen Observation von Personen, die Arbeit mit sogenannten V-Leuten und die Überwachung von Kommunikation umfasst.
Die AfD hat angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen und eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu beantragen. Dabei wird die nächste Instanz lediglich Rechtsfehler prüfen können, ohne neue Beweisanträge zuzulassen.
Dieses jüngste Urteil fällt in eine Zeit politischer Spannung und könnte die öffentliche Wahrnehmung der AfD weiter prägen, insbesondere im Kontext anstehender Wahlen.
Links
- https://www.n-tv.de/politik/Niederlage-vor-Gericht-Der-AfD-droht-nun-eine-noch-hoehere-Einstufung-durch-den-Verfassungsschutz-article24937425.html
- https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-ovg-verdachtsfall-100.html
- https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024-05/verfassungsschutz-darf-afd-als-rechtsextremen-verdachtsfall-fuehren

TikTok und die demokratischen Parteien, es tut sich was
28.04.24
Habeck nutzt es inzwischen geschickt, das soll der Anlass sein, noch einmal über TikTok zu sprechen, zumal die Kommentare auf X unter https://x.com/MissJen80/status/ dafür sprechen, dass die Gründen und insb. Minister Habeck das Rennen um die sozialen Medien noch lange nicht gewonnen haben. Auch Frau Strack-Zimmermann nutzt das Medium geschickt: https://www.tiktok.com/@strackzimmermann/video/7361842807281175841
In einer Welt, in der soziale Medien zunehmend das politische Klima prägen, ist TikTok zu einer mächtigen Plattform im Meinungskampf geworden. Besonders in Deutschland hat die AfD die Fähigkeiten von TikTok erkannt und nutzt die Plattform geschickt, um junge Menschen zu erreichen und zu beeinflussen. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen über die Rolle von TikTok in der Demokratie und die Verantwortung sozialer Netzwerke auf.
Die AfD ist auf TikTok besonders aktiv und erfolgreich, indem sie Inhalte verbreitet, die oft populistisch und emotional geladen sind. Diese Inhalte finden durch den Algorithmus von TikTok, der kontroversen Content bevorzugt, eine massive Verbreitung. Der Erfolg der AfD auf der Plattform hat andere politische Parteien alarmiert, die bisher die Bedeutung von TikTok unterschätzt hatten.
Die Kampagne #ReclaimTikTok, unterstützt von Aktivisten wie Luisa Neubauer und anderen politischen Figuren, zielt darauf ab, den demokratischen Diskurs zurück auf die Plattform zu bringen und eine Gegenbewegung zu den rechten Inhalten zu etablieren. Diese Bemühungen sind jedoch eine Herausforderung, da die AfD ein ausgeklügeltes Netzwerk von Accounts besitzt, die ihre Reichweite weiter verstärken.
Die kürzliche Maßnahme von TikTok, die Reichweite des AfD-Politikers Maximilian Krah aufgrund von Verstößen gegen die Community-Richtlinien stark einzuschränken, zeigt, dass das Unternehmen beginnt, gegen die Verbreitung schädlicher Inhalte aktiv vorzugehen. Diese Entscheidung ist ein Schritt, um die Integrität des politischen Diskurses zu wahren, und ein Zeichen dafür, dass TikTok seine Rolle in der demokratischen Gesellschaft ernst nimmt.
TikTok bietet durch seine algorithmische Kuratierung die einzigartige Möglichkeit, dass auch politisch fördernde Inhalte viral gehen können, ohne dass eine große Anzahl von Followern nötig ist. Dies bietet eine Chance für demokratische Kräfte, ihre Botschaften effektiv zu verbreiten und insbesondere jüngere Zielgruppen zu erreichen, die die Plattform intensiv nutzen.
Die politische Landschaft auf TikTok ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie digitale Technologien die Demokratie sowohl herausfordern als auch stärken können. Für politische Parteien und Aktivisten bietet TikTok eine wichtige Plattform, um die junge Generation zu erreichen und für demokratische Werte zu werben.
Text: Blog-Team
Bild: KI
Links
- Habeck im TikTok-Format:
https://x.com/MissJen80/status/1784245622289162345
- @strackzimmermann
https://www.tiktok.com/@strackzimmermann
- https://www.tiktok.com/@strackzimmermann/video/7361842807281175841
- Die TikTok-Taktik
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/tiktok-afd-102.html
- https://www.deutschlandfunk.de/tiktok-schraenkt-afd-account-ein-100.html
Es wird Zeit! - Bodo Wartke
Aus den Shownotes:
"Ich habe mal zu Ende gedacht, was es für Konsequenzen für unsere Gesellschaft hätte, wenn wir einen Autokraten, den sogenannten 'starken Mann', als politischen Führer für unser Land zulassen würden", so Bodo über sein Lied "Es wird Zeit!". #niewiederistjetzt #eswirdzeit Seit 2019 singt Bodo diese Lied. Es ist seit 2020 Bestandteil seines Klavierkabarettprogramms "Wandelmut". Dieser Ausschnitt stammt aus Bodos Konzertfilm "Wandelmut".
Die fünf Kerninfos zum Klimawandel
1. Er ist real.
2. Wir sind die Ursache.
3. Er ist gefährlich.
4. Die Fachleute sind sich einig.
5. Wir können noch etwas tun.
1. It’s real.
2. It’s us.
3. Experts agree.
4. It’s bad.
5. There’s hope.
Link
- Gefunden im Faktenpapier Klimawandel 2023
https://www.helmholtz-klima.de/sites/default/files/medien/dokumente/faktenpapier2023_final2.pdf
- IPCC-Berichte und Zusammenfassung
https://www.de-ipcc.de/270.php#Downloads%20Berichte
- Link zum Video
https://youtu.be/TbtVXWNrN9o?si=YOK-01Jc037X0nbX
Zur Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Leiserowitz
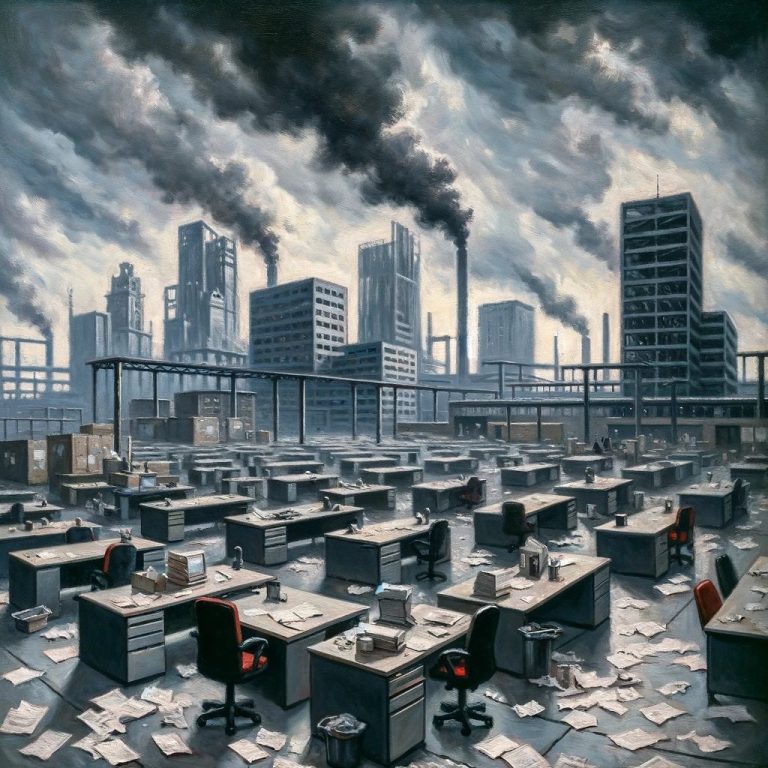
Folgen eines #Dexit
22.04.24
Ein Austritt Deutschlands aus der EU, auch als Dexit bezeichnet, hätte gravierende wirtschaftliche Folgen: Ein Verlust von 2,2 Millionen Arbeitsplätzen und ein Rückgang des Wachstums um sechs Prozent könnten eintreten. Die AfD hat sich kürzlich erneut für diesen Schritt ausgesprochen. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), kritisiert diese Pläne in der Süddeutschen Zeitung (am 28. Januar 2024): „Wenn man das Land ruinieren will, muss man das so machen.“ Ein solcher Schritt könnte heute einen finanziellen Schaden von 400 bis 500 Milliarden Euro verursachen. „Deutschland würde sicher stärker unter einem EU-Austritt leiden als Großbritannien“, erklärt Hüther. Der Hauptgrund dafür ist, dass Deutschland stark von dem Zugang zum EU-Binnenmarkt profitiert hat. Ein Austritt würde nicht nur zu ungünstigeren Handelsbedingungen führen, sondern auch das Wechselkursrisiko erhöhen. „Wenn wir in Deutschland von einem Wachstumsverlust von fünf Prozent ausgehen, wären dies 2,2 Millionen Arbeitsplätze weniger“, unterstreicht Hüther.
Links
- https://de.linkedin.com/posts/institut-der-deutschen-wirtschaft_dexit-eu-afd-activity-7157749203111198721-y7GP
- https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wirtschaft/afd-wirtschaftspolitik-sozialpolitik-oekonomen-einschaetzung-e224429/?reduced=true
Text: Blog-Team
Bild: KI

Die Woche
Unsere Wochendiskussion im Überblick
Politische Partizipation und demokratische Werte:
- Diskussionen über die Teilnahme von Parteien an Wahlkämpfen, die Aufstellung von Ständen und die Mobilisierung gegen rechtsextreme Gruppen wie die AfD sind zentral.
- Es wird betont, dass es wichtig ist, klar gegen rechtsextreme Parteien Position zu beziehen und gleichzeitig die demokratischen Werte zu stärken.
Migration und Flüchtlingspolitik:
- Die Debatte über die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in Deutschland und die Rolle der EU wird thematisiert. Die Belastung der Landkreise und die Forderung nach einer politischen Debatte über die Aufnahmekapazitäten stehen im Fokus.
- Artikel zur Kritik des Landkreistagspräsidenten an der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter
Engagement gegen Rechtsextremismus:
- Es wird eine Vielzahl von Aktionen und Meinungen diskutiert, wie man am besten gegen rechtsextreme Parteien und Einstellungen vorgehen sollte, von satirischen Aktionen bis hin zu ernsthaften Diskussionen.
- Aufstehen gegen Rassismus – Aktionsanleitungen
Umwelt- und Wirtschaftspolitik:
- Die Bedeutung von wirtschaftlichen Entscheidungen Chinas und deren globale Auswirkungen, insbesondere auf Umwelt und Klima, werden besprochen.
- Artikel zur Bondensenkung in China und dessen Folgen
Sozialpolitik:
- Diskussion über die Forderungen der FDP zu Bürgergeld und die ideologischen Spannungen innerhalb der Koalition.
- FDP fordert Sofortabzug von 30 Prozent bei Bürgergeld
Text: Blog-Team
Bild: KI
Wir zerstören eine Demokratie
20.04.24
In seiner satirischen Rede auf dem For..Net Symposium skizziert Anwalt Jun ein dystopisches Szenario, in dem eine Demokratie systematisch zerstört wird. Sein Vortrag, der in einem zynisch-humorvollen Ton gehalten wird, soll die Fragilität von Demokratien aufzeigen und vor den Gefahren einer solchen Zersetzung warnen.
Grundlage schaffen durch Unzufriedenheit: Jun beginnt mit der Prämisse, dass starke Emotionen wie Neid, Hass und Ablehnung eine fruchtbare Grundlage für die Destabilisierung einer Demokratie bieten. Diese Emotionen schaffen Aufmerksamkeit und Viralität in sozialen Medien, was sie zu einer mächtigen Waffe im Kampf gegen demokratische Institutionen macht.
Angriff auf die Institutionen: Der nächste Schritt in Juns hypothetischem Rezept ist der Angriff auf die Institutionen der Demokratie. Indem man die Glaubwürdigkeit und Integrität von Politikern und politischen Parteien untergräbt, fördert man ein Klima des Misstrauens gegenüber dem System selbst. Hierzu zählt er das persönliche Diffamieren von Politikern als leicht zu erreichendes Ziel.
Verbreitung von Fake News und Desinformation: Jun weist darauf hin, dass die Verbreitung von falschen Informationen und Fake News eine effektive Methode ist, um Zweifel und Misstrauen zu säen. Er betont die Rolle von modernen Technologien wie KI und Deepfakes, die das Erzeugen und Verbreiten von Falschinformationen vereinfachen.
Erosion des Glaubens an die Verfassung: Ein weiterer kritischer Punkt ist der Angriff auf die Grundwerte und Prinzipien, auf denen eine Demokratie basiert, wie die Menschenwürde und die Rechtsstaatlichkeit. Jun beschreibt, wie man durch das Neudefinieren dieser Werte ihre Bedeutung aushöhlen und das Vertrauen in die Verfassung schwächen kann.
Ausnutzung von Gesetzeslücken: Der Vortrag hebt hervor, dass bestehende Gesetze oft nicht ausreichen, um gegen neue Formen der Desinformation und Demokratiegefährdung vorzugehen. Jun kritisiert das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das Strafrecht, das nicht effektiv genug sei, um gegen die Verbreitung von gefährlichen Falschinformationen vorzugehen.
Aufforderung zur Wachsamkeit und Handlung: Abschließend ruft Jun zur Wachsamkeit und zu konkreten Handlungen auf. Er betont die Notwendigkeit, rechtliche Rahmenbedingungen zu überdenken und anzupassen, um die Demokratie vor solchen Angriffen effektiv schützen zu können.
Juns Vortrag dient als Warnung und Weckruf, die Prozesse und Mechanismen zu verstehen, die zur Unterminierung von Demokratien führen können. Indem er eine Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie bietet, illustriert er, wie wichtig es ist, demokratische Werte aktiv zu verteidigen und die rechtlichen sowie institutionellen Strukturen zu stärken.
Text: Blog-Team

Warum die Grünen zum Feindbild der Rechten wurden
19.04.24
In der aktuellen politischen Landschaft Deutschlands haben sich Die Grünen als Hauptziel rechter Anfeindungen etabliert. Dies manifestiert sich in zunehmend aggressiven Protesten und Übergriffen, die sich gegen Vertreter der Partei richten. Aber warum sind gerade die Grünen zu einem solchen Feindbild avanciert?
Erfolge in der politischen Mitte
Die Grünen haben sich erfolgreich als pragmatische Mitte-Partei positioniert, was ihnen wachsenden politischen Einfluss und Erfolge in verschiedenen Bundesländern sicherte. Ihre Prominenz und die damit verbundene Sichtbarkeit machen sie zum strategischen Ziel für Angriffe von politischen Gegnern. Diese Entwicklung erreichte im Sommer 2022 einen Höhepunkt, als die Partei in Umfragen und bei Landtagswahlen besonders stark abschnitt.
Umweltpolitische Maßnahmen
Ein wesentlicher Grund für die Feindseligkeiten ist das umweltpolitische Engagement der Grünen. Maßnahmen wie das Heizungsgesetz, das auf den Austausch alter Heizsysteme gegen klimafreundlichere Alternativen abzielt, stießen auf erheblichen Widerstand. Kritiker, insbesondere aus der FDP, warfen den Grünen vor, zu einseitig auf bestimmte Technologien wie die Wärmepumpe zu setzen und damit die Bürger zu überfordern.
Konflikt mit landwirtschaftlichen Interessen
Ein weiterer Brennpunkt sind die Auseinandersetzungen mit der Landwirtschaft. Die von den Grünen mitgetragenen Vorschläge zur Reduzierung von Subventionen für die Landwirtschaft führten zu massiven Protesten von Bauern, die ihre Existenz bedroht sahen. Diese Konflikte verschärften sich, als Rechtsextremisten begannen, die Bauernproteste für ihre Zwecke zu nutzen und gegen die Grünen zu mobilisieren.
Angriffe und Radikalisierung
Die Zunahme von Übergriffen gegen die Grünen, insbesondere durch Rechtsextreme, hat die Partei zum meistangegriffenen politischen Ziel in Deutschland gemacht. Die Polizei registrierte im letzten Jahr fast 1.200 Straftaten gegen ihre Vertreter. Diese Gewalt wird oft von populistischen und rechtsextremen Gruppen geschürt, die die Grünen als Bedrohung für traditionelle deutsche Werte darstellen.
Medienkampagnen und Desinformation
Neben physischen Angriffen sehen sich die Grünen auch mit einer Flut von Desinformation und negativen Medienkampagnen konfrontiert. Beispiele hierfür sind die von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) finanzierten Anzeigen, die die Grünen als Verbotspartei brandmarkten. Solche Kampagnen verstärken das Bild der Grünen als Gegner traditioneller deutscher Werte und schüren weiteren Hass.
Fazit
Die Positionierung der Grünen als Partei, die pragmatische und umweltbewusste Politik verfolgt, hat sie zu einem bevorzugten Ziel für Angriffe gemacht. Während sie auf der einen Seite für ihren Einsatz für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gelobt werden, werden sie von rechten und populistischen Gruppen als Bedrohung wahrgenommen. Diese dynamische und oft feindliche Situation fordert von den Grünen sowohl Resilienz als auch ein kluges und strategisches Vorgehen, um ihre politischen Ziele weiterhin effektiv verfolgen zu können.
Links
- https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/feindbild-gruene-100.html
- https://www.tagesschau.de/investigativ/negative-kampagne-gruene-101.html
- https://www.stern.de/gesellschaft/regional/mecklenburg-vorpommern/parteien--gruene-sagen-rechtsextremismus-den-kampf-an-34625474.html
- https://www.dw.com/de/bauernproteste-feindbild-gr%C3%BCne/a-68384817
Text: Blog-Team
Bild: KI

Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung für das Jahr 2022/23
18.04.24
Was ist eigentlich rechtsextrem und wie verbreitet ist Rechtsextremismus in Deutschland? Hierzu gibt die Mitte-Studie Antworten auf viele Fragen.
Was ist rechtsextrem?
Rechtsextremismus wird als eine spezifische Ideologie charakterisiert, die sich durch eine antidemokratische Opposition gegenüber Gleichheit auszeichnet. Diese Ideologie ist oft mit Rassismus, Xenophobie, ausschließendem Nationalismus, Verschwörungstheorien und Autoritarismus verbunden. In der politischen Landschaft wird Rechtsextremismus auf einem Spektrum verortet, das radikal konservativ, ultra-nationalistisch und autoritär ist.
Die Definition von Rechtsextremismus umfasst oft auch politisch motivierte Gewalt oder die Rechtfertigung solcher Gewalt als Mittel zur Erreichung politischer Ziele innerhalb eines demokratischen Systems, in dem der Staat das Gewaltmonopol hat. Häufige Ziele rechtsextremer Gewalt sind Immigranten, ethnische und religiöse Minderheiten sowie linke Politiker und Aktivisten.
Die aktuelle Mitte-Studie
Die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung für das Jahr 2022/23 zeigt eine deutliche Zunahme rechtsextremer und demokratiegefährdender Einstellungen in Deutschland.
Die Studie, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, zielt darauf ab, den Zustand der "demokratischen Mitte" zu untersuchen, indem sie Fragen zur Zufriedenheit mit der Demokratie und ihren Institutionen sowie zur Zustimmung zu rechtsextremistischen und demokratiegefährdenden Aussagen stellt. Bemerkenswert ist, dass insbesondere junge Menschen zunehmend rechtsextreme Ansichten vertreten, und dass diese Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft immer mehr Anklang finden.
- Rechtsextremes Weltbild: Etwa 8% der Bevölkerung identifizieren sich klar mit einem rechtsextremen Weltbild, eine signifikante Steigerung im Vergleich zu früheren Jahren, wo dieser Anteil bei etwa 2-3% lag.
- Befürwortung einer Diktatur: Über 6% der Befragten befürworten eine Diktatur mit einer starken Partei und einem Führer an der Spitze Deutschlands.
- Nationalchauvinismus (*) und Fremdenfeindlichkeit: Ein signifikanter Anstieg ist ebenfalls in der Zustimmung zu nationalchauvinistischen (16%) und fremdenfeindlichen Einstellungen (über 6%) zu verzeichnen.
Die Studie weist auch auf eine Zunahme von verschwörungsgläubigen (38%), populistischen (33%) und völkisch-autoritär-rebellischen (29%) Positionen hin. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und das Funktionieren der Demokratie sinkt, wobei etwa 60% der Befragten dieses noch als stabil betrachten.
Diese Ergebnisse verdeutlichen die Dringlichkeit, dass sowohl politische Maßnahmen als auch gesellschaftliche Initiativen verstärkt werden müssen, um den demokratischen Grundwerten wieder mehr Geltung zu verschaffen und rechtsextremen Tendenzen entgegenzuwirken. Die gesellschaftliche Mitte ist mehr denn je gefordert, eine klare Haltung gegen Menschenfeindlichkeit und antidemokratische Einstellungen zu zeigen.
___
(*) Nationalchauvinismus bezeichnet eine extreme Form des Nationalismus, bei der die Überlegenheit der eigenen Nation gegenüber anderen betont und gefördert wird. Diese Ideologie ist oft mit einer starken Ablehnung oder Abwertung anderer Kulturen oder Nationen verbunden und kann zu aggressivem oder diskriminierendem Verhalten führen.
Nationalchauvinisten glauben, dass die Interessen und Kultur ihrer eigenen Nation höherwertig und wichtiger sind als die der anderen und dass diese Überlegenheit politische, wirtschaftliche oder militärische Dominanz rechtfertigt. In der Politik kann Nationalchauvinismus dazu führen, dass internationale Kooperationen abgelehnt oder fremdenfeindliche Gesetze und Politiken gefördert werden.
Links
- https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/publikationen/studien/gutachten
- https://www.deutschlandfunk.de/rechtsextremismus-mitte-studie-rechtsextrem-weltbild-100.html
- https://taz.de/Mitte-Studie-der-Ebert-Stiftung/!5961642/
Text: Blog-Team
Bild: KI
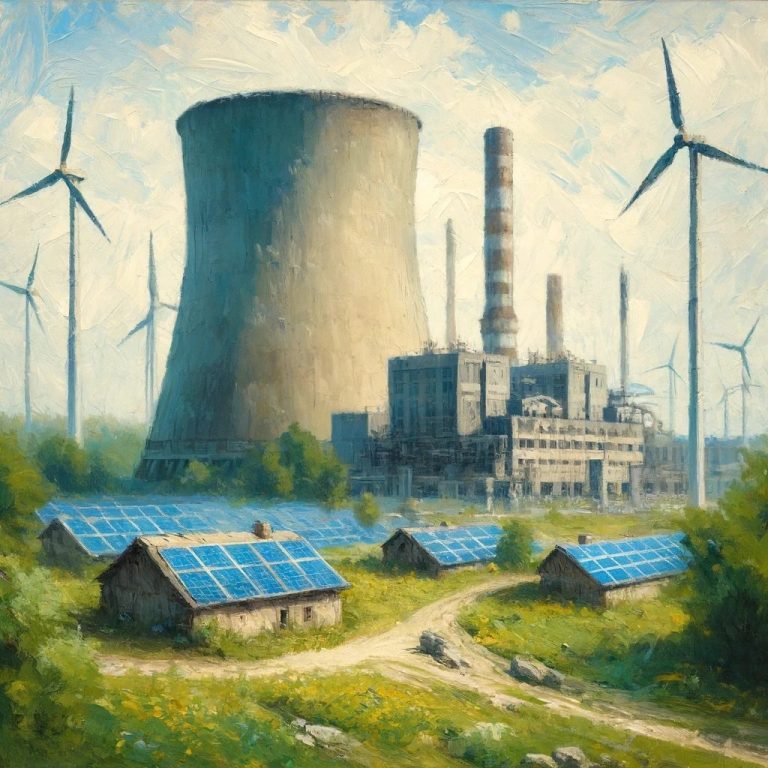
Ein Jahr ohne Atomstrom in Deutschland: Eine Analyse in drei Teilen
16.04.24
Teil 1 - Na klar! - Die AfD warnt vor der Abschaltung von Atomkraftwerken (2018) - eine Analyse, insb. der populistischen Elemente
"Kernenergie – Na klar!" - sagt die AfD Sachsen auf einer eigens gestalteten Seite Pro-Atomkraft. Bereits 2018 war die AfD gegen den Atomausstieg, wie ein Youtube-Video zteigt (bitte Quelle selbst suchen, sie wird nicht verlinkt).
Die AfD macht Stimmung! Was ist ihr Bestreben?
Die AfD kritisiert 2018 die Entscheidung der damaligen schwarz-gelben Regierung zum Atomausstieg als überstürzt und sieht die daraus resultierenden Entschädigungszahlungen an Energiekonzerne wie RWE und Vattenfall als eine Belastung für die Steuerzahler. Die Partei argumentiert, dass die deutschen Steuerzahler nun für die politischen Entscheidungen bezahlen müssten, die aufgrund der Reaktion auf die Fukushima-Katastrophe getroffen wurden. Dabei wird auf die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke verwiesen, die 2010 beschlossen wurde und die nun nicht umgesetzt werden kann, wodurch den Kraftwerksbetreibern Gewinne entgehen. Diese Entscheidungen führen nach Ansicht der AfD zu unnötigen Kosten im Milliardenbereich, die letztlich von der Allgemeinheit getragen werden müssen.
Populismus-Analyse: Atomausstiegsprotest der AfD:
mehrere klassische populistische Elemente
Die AfD nutzt in ihrer Argumentation im Video gegen den Atomausstieg mehrere klassische populistische Elemente, um ihre Botschaft zu verstärken und bestimmte Wählersegmente anzusprechen:
Feindbild Konstruktion: Die AfD stellt die frühere schwarz-gelbe Regierung als verantwortungslos dar und schafft somit ein klares Feindbild. Dies verstärkt die Wahrnehmung von "uns" (die Bürger und Steuerzahler, die angeblich vernünftig sind und unter den Fehlentscheidungen leiden) gegen "sie" (die politischen Eliten, die Fehler gemacht haben).
Opferrolle der Bevölkerung: Durch die Betonung, dass die "Steuerzahler mal wieder ausbaden" müssen, was die Regierung "eingebrockt" habe, spricht die AfD direkt das Gefühl vieler Bürger an, die finanziellen Lasten von politischen Fehlentscheidungen tragen zu müssen. Dieses Narrativ von der ungerechten Last kann bei Personen, die sich bereits steuerlich oder finanziell benachteiligt fühlen, Resonanz finden.
Vereinfachung und Dramatisierung: Die Argumentation suggeriert eine direkte und unmittelbare Kausalität zwischen dem Atomausstieg und hohen Kosten für die Allgemeinheit, ohne die komplexen Zusammenhänge der Energiepolitik und langfristigen wirtschaftlichen und ökologischen Überlegungen zu berücksichtigen. Durch die Dramatisierung der finanziellen Folgen ("einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich") wird versucht, Emotionalität und Dringlichkeit zu erzeugen.
Rückwärtsgewandte Politik: Die Erwähnung der Laufzeitverlängerung, die 2010 beschlossen wurde, nutzt die Nostalgie für vergangene Entscheidungen als vermeintlich bessere Lösung im Gegensatz zu den aktuellen politischen Entwicklungen. Dies spricht Wähler an, die Veränderungen skeptisch gegenüberstehen und sich nach einer Rückkehr zu einer als stabiler wahrgenommenen Vergangenheit sehnen.
Durch diese Elemente spricht die AfD gezielt Wähler an, die unzufrieden mit der aktuellen politischen Situation sind, sich von den etablierten Parteien nicht vertreten fühlen und für die eine einfache, klar gegliederte politische Kommunikation attraktiv ist. Diese Art der populistischen Rhetorik zielt darauf ab, Unzufriedenheit zu mobilisieren und politisches Kapital aus der Angst und Frustration der Bevölkerung zu schlagen.
Teil 2 - Inhaltliche Fortsetzung: Ein Jahr ohne (deutschen) Atomstrom - eine Bilanz
Seit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland im April 2023 haben sich viele der befürchteten negativen Folgen nicht bewahrheitet. Entgegen den Warnungen vor Blackouts und exorbitanten Strompreisen zeigt sich ein Jahr später ein überraschend positives Bild der Energieversorgung in Deutschland.
Die Befürchtungen und die Realität
Im Vorfeld der endgültigen Abschaltung der Atomkraftwerke – Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland – gab es erhebliche Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit und Preisstabilität. Kritiker warnten vor einer Gefährdung der Energieversorgung und vor steigenden Strompreisen. Diese Sorgen erwiesen sich jedoch als weitgehend unbegründet.
Preisentwicklung und Energieversorgung
Trotz der Abschaltung der Kernkraftwerke sind die Strompreise signifikant gefallen. Laut Daten des Vergleichsportals Verivox sank der Preis für eine Kilowattstunde von 33,83 Cent im April 2023 auf 26,05 Cent ein Jahr später. Auch die Großhandelspreise für Strom haben sich fast halbiert, von 99,01 Euro pro Megawattstunde im April 2023 auf 55,01 Euro im April 2024.
Ersatz durch erneuerbare Energien
Die Stromerzeugung aus Kernkraft wurde erfolgreich durch erneuerbare Energien ersetzt. Laut Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme wurde der Wegfall der Kernenergie durch eine gestiegene Erzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie durch Einsparungen und Importe ausgeglichen. Im ersten Jahr ohne Kernenergie stieg die Produktion erneuerbarer Energie auf etwa 270 Terawattstunden, was einem Anteil von 58,8 Prozent am Strommix entspricht.
Rückgang der fossilen Stromerzeugung
Parallel dazu ist die Stromgewinnung aus fossilen Brennstoffen zurückgegangen. Dieser Rückgang wurde durch hohe Kosten für Erdgas, Kohle und CO2-Zertifikate beschleunigt. Die Gesamtstromnachfrage in Deutschland verringerte sich ebenfalls, was teilweise auf die erhöhte Selbstnutzung von Photovoltaikstrom zurückzuführen ist.
Importe und europäischer Markt
Interessanterweise sind die Stromimporte gestiegen, was hauptsächlich auf die attraktiveren Preise für erneuerbare Energie in den Nachbarländern zurückzuführen ist. Deutschland importierte mehr Strom, besonders im Sommer, als erneuerbare Energien in den Alpen und Skandinavien besonders günstig waren.
Fazit
Ein Jahr nach dem vollständigen Atomausstieg in Deutschland zeigt sich, dass die Umstellung auf eine stärker von erneuerbaren Energien geprägte Stromversorgung erfolgreich war. Die Energiesicherheit wurde nicht beeinträchtigt, und die Strompreise sind gesunken, was die Lebenshaltungskosten für Verbraucher positiv beeinflusst hat. Dies demonstriert, dass der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch tragfähig ist. Trotz anfänglicher Skepsis und Kritik hat Deutschland gezeigt, dass ein energiewirtschaftlicher Wandel möglich ist, der sowohl die Umwelt schont als auch die Wirtschaft unterstützt.
Teil 3: Und Frankreich?
Die Welt lacht über Deutschland, alle bauen Atomkraft aus, Frankreicht macht es richtig, Ach ja?
Die Strompreisentwicklung in Frankreich wird derzeit maßgeblich durch den starken Fokus des Landes auf die Kernenergie beeinflusst. Frankreich, das fast zwei Drittel seines Stroms aus Atomkraftwerken bezieht, steht vor erheblichen Herausforderungen. Die Schuldenlast des staatlichen Energiekonzerns EDF, bedingt durch die Unterbewertung der Produktionskosten beim Verkauf von Atomstrom, und die anstehende Aufhebung des Preisdeckels sind zentrale Faktoren, die zu einer drastischen Preissteigerung führen.
Die bisher praktizierte Preisregulierung ermöglichte es EDF, Atomstrom zu einem festgelegten Preis von 42 Euro pro Megawattstunde zu verkaufen, was deutlich unter den eigentlichen Produktionskosten lag. Diese künstlich niedrigen Preise waren nicht nachhaltig und führten zu erheblichen finanziellen Belastungen für den Konzern, was sich letztendlich in einer Schuldenlast von fast 65 Milliarden Euro widerspiegelte. Ab 2026 wird der Preis für Atomstrom auf 70 Euro pro Megawattstunde angehoben.
Neben den wirtschaftlichen Belastungen stehen technische und ökologische Herausforderungen im Raum. Die Atomkraftwerke in Frankreich sind in die Jahre gekommen, und viele benötigen teure Renovierungen, um den Sicherheitsstandards zu entsprechen. Dies führte zeitweise dazu, dass fast die Hälfte der französischen Anlagen nicht funktionstüchtig war, was Importe von Strom aus dem Ausland notwendig machte.
Trotz dieser Herausforderungen und der wachsenden Kritik an der Kernenergie setzt die französische Regierung weiterhin auf diese Energieform. Neue Atomkraftwerke sind geplant, obwohl bereits der Bau existierender Anlagen wie in Flamanville weit über Budget und Zeitplan hinausging.
Fazit
Das Fazit zur Debatte um die Kernenergie, insbesondere im Kontext neuer Kraftwerke und Technologien, zeichnet ein klares Bild: Die angenommenen Vorteile der Atomenergie stehen in starkem Kontrast zu den tatsächlichen ökonomischen und technischen Herausforderungen. Die langen Bauzeiten und die enormen Kosten, die mit dem Bau neuer Atomkraftwerke verbunden sind, sowie die Notwendigkeit staatlicher Subventionen unterstreichen die finanzielle Untragbarkeit dieser Energieform. Auch die Idee kleiner modularer Reaktoren, die oft als zukunftsträchtige Lösung präsentiert wird, erweist sich bei genauer Betrachtung als unrealistisch und nicht finanzierbar.
Die wirtschaftliche Analyse zeigt deutlich, dass die externen Kosten, die mit Neubau, Betrieb und Endlagerung von Atomkraft verbunden sind, den Atomstrom zu einer der teuersten Energieformen machen. Im Vergleich dazu sind erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie wesentlich kostengünstiger und effizienter. Dies legt nahe, dass die fortgesetzte Investition in Kernenergie nicht nur eine finanzielle Belastung darstellt, sondern auch eine verpasste Gelegenheit, in saubere, erneuerbare Technologien zu investieren, die eine nachhaltigere und kosteneffektivere Energieversorgung bieten könnten.
Angesichts dieser Umstände erscheint es sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Perspektive sinnvoll, das Kapitel der Kernenergie in Deutschland zu schließen und stattdessen den Ausbau erneuerbarer Energiequellen energisch voranzutreiben.
Links
- https://www.swr.de/swraktuell/ein-jahr-ohne-atomkraft-atomstrom-strompreis-gesunken-100.html
- https://www.deutschlandfunk.de/ein-jahr-ohne-atomstrom-horrorszenarien-blieben-aus-dlf-69077ee5-100.html
- https://www.stern.de/wirtschaft/ein-jahr-ohne-atomstrom--wie-ist-die-bilanz-des-kernkraftausstiegs--34630246.html
- https://www.wiwo.de/unternehmen/energie/ein-jahr-atomausstieg-fehlen-deutschland-die-kernkraftwerke/29753670.html
- https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/atomausstieg-das-ist-die-bilanz-nach-einem-jahr/100032488.html
- https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/atomenergie-strom-frankreich-100.html
- AfD-Video: Bitte selbst suchen, wenn es angeschaut werden muss, das Video wird hier nicht verlinkt - 24.05.2018:
Youtube: Bürger zahlen die Zeche für den Atomausstieg! - AfD-Fraktion im Bundestag
- Kernenergie – Na klar! (2023/4?) - Afd-Fraktion Sachsen
Bitte selbst suchen, die Seite wird hier nicht verlinkt
- https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article238121499/atomkraft-deutschland-energieexpertin-strompreis-mittelstand.html
Text: Blog-Team
Bild: KI

Engagement gegen Rechtsextremismus: Wie jeder Einzelne aktiv werden kann
15.04.24
Im Kampf gegen Rechtsextremismus in Deutschland gibt es vielfältige Ansätze und Methoden, wie sich Einzelne engagieren können.
Hier eine zusammenfassende Übersicht verschiedener empfohlener Maßnahmen basierend auf den recherchierten Quellen:
Sichtbarkeit und politisches Engagement
Demonstrationen und öffentliche Veranstaltungen bieten eine Plattform, um gegen Rechtsextremismus Stellung zu beziehen. Diese Form der Sichtbarkeit hilft, das Meinungsklima positiv zu beeinflussen und demokratische Werte zu stärken. Wer nicht aktiv an Protesten teilnehmen kann oder möchte, hat die Möglichkeit, durch kleinere Gesten wie das Verteilen von Stickern oder das Ansprechen von Lokalpolitikern im Rahmen von Bürgersprechstunden, seine Meinung kundzutun.
Engagement in der Gemeinschaft
Das Übernehmen von Verantwortung in gemeinnützigen Organisationen oder die Teilnahme an Stadtteilfesten und in der Obdachlosenhilfe sind wichtige Maßnahmen, um soziale Leerstellen nicht den Rechten zu überlassen. Organisationen wie die Amadeu-Antonio-Stiftung bieten hierfür Fortbildungen und Seminare an, die auf die Sensibilisierung und das Erkennen von Rechtsextremismus abzielen.
Aufklärung und Bildung
Aufklärung über die Gefahren des Rechtsextremismus und die Verbreitung menschenfeindlicher Ideologien ist essentiell. Durch Gespräche im privaten und öffentlichen Raum sowie die Nutzung von Bildungsangeboten können Vorurteile abgebaut und das Bewusstsein für die Thematik geschärft werden. Die Beteiligung an Diskussionen und das korrekte Reagieren auf rassistische oder diskriminierende Äußerungen sind hierbei zentrale Fähigkeiten.
Digitales Engagement
In der digitalen Welt ist es wichtig, auf menschenverachtende Inhalte zu reagieren. Das Melden von Hasskommentaren und die Unterstützung von Aufklärungskampagnen im Netz sind einfache Schritte, die jeder Einzelne unternehmen kann. Organisationen wie HateAid oder REspect! bieten hierfür Anlaufstellen.
Selbstschutz und Unterstützung Betroffener
Bei allen Aktivitäten sollte der Selbstschutz nicht vernachlässigt werden. Für Betroffene rechter Gewalt existieren Beratungsstellen in allen Bundesländern, die sowohl vor als auch nach Demonstrationen Unterstützung bieten können.
Respekt und Dialog
Auch wenn der politische Kampf gegen Rechtsextremismus oft harte Auseinandersetzungen mit sich bringt, ist der Respekt vor dem politischen Gegner ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Während rechtsextreme Einstellungen klar verurteilt werden müssen, ist es auch notwendig, mit Anhängern rechter Parteien in einen konstruktiven Dialog zu treten, um Missverständnisse auszuräumen und möglicherweise Überzeugungsarbeit zu leisten.
Diese Ansätze zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Jeder Beitrag zählt und kann dazu beitragen, die Demokratie zu stärken und menschenfeindliche Ideologien zurückzudrängen.
Links
- https://www.deutschlandfunkkultur.de/was-kann-man-gegen-rechtsextremismus-tun-100.html (Mitmachsendung mit Expert*innen Begrich, David; Kieschnick, Birgit - 90 min)
- https://www.rnd.de/wissen/was-sie-gegen-rechtsextremismus-tun-koennen-YFSO5JYHTVCUHGK22PLE5YKEV4.html
- https://www.ksta.de/ratgeber/verbraucher/koelner-initiativen-gegen-rechts-was-wir-alle-gegen-rechtsextremismus-tun-koennen-723537
- https://www.deutschlandfunk.de/rechtsextremismus-afd-demokratie-zivilcourage-100.html
- https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2024-01/engagement-gegen-rechtsextremismus-demo-ehrenamt
Text: Blog-Team
Bild: KI
Ein Jahr Atomenergieausstieg in Deutschland
13.04.2024
Die Debatte um den Atomausstieg in Deutschland und den gleichzeitigen Ausbau der Kernenergie in Großbritannien verdeutlicht die unterschiedlichen Energiepolitiken und -strategien der beiden Länder.
Deutschland hat nach den Reaktorunfällen in Tschernobyl und Fukushima beschlossen, komplett aus der Atomenergie auszusteigen. Dieser Schritt wurde durch die Bundesregierung als notwendig erachtet, um langfristige Sicherheitsrisiken zu vermeiden und eine nachhaltigere Energiepolitik zu verfolgen. Trotz der Herausforderung, dass durch den Atomausstieg kurzfristig ein höherer Anteil an Kohlestrom genutzt werden musste, zeigen neuere Daten, dass Deutschland seine Kohlestromproduktion deutlich reduzieren konnte und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien steigert. Die Entscheidung, aus der Atomkraft auszusteigen, wurde auch durch die öffentliche Meinung und Umweltbedenken unterstützt, und das Land hat erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien getätigt, um die entstandene Lücke zu schließen.
Großbritannien hingegen sieht in der Kernkraft eine wichtige Komponente seiner zukünftigen Energiestrategie, insbesondere im Hinblick auf die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der Verbesserung der Energieunabhängigkeit. Der britische Plan, die Atomkapazitäten zu vervierfachen, zielt darauf ab, einen bedeutenden Anteil des Energiebedarfs durch Kernenergie zu decken. Dies wird durch den Bau neuer Anlagen und die Entwicklung moderner Technologien wie kleiner, modularen Reaktoren vorangetrieben. Großbritannien stößt dabei allerdings auf Herausforderungen wie hohe Kosten, technologische Risiken und Verzögerungen bei aktuellen Projekten.
Vergleich und Aussichten:
Kosten und Wirtschaftlichkeit: Die Kernenergie wird oft als kostengünstige Option für die langfristige Stromerzeugung angesehen. Allerdings sind die Anfangsinvestitionen sehr hoch, und die Kosten können weiter steigen, wie das Beispiel Hinkley Point C zeigt. Erneuerbare Energien haben hingegen signifikant geringere Gestehungskosten, vor allem bei Sonne und Wind, und die Kosten sinken weiterhin durch technologische Fortschritte.
Sicherheit und Umwelt: Die Atomkraft birgt Risiken, insbesondere durch Unfälle und die Langzeitlagerung von radioaktivem Abfall. Deutschland hat sich daher für einen Weg entschieden, der diese Risiken eliminiert, während Großbritannien die Sicherheitsstandards erhöht und in neue Technologien investiert, um die Risiken zu minimieren.
Energieunabhängigkeit: Während Großbritannien durch den Ausbau der Kernkraft seine Energieunabhängigkeit stärken möchte, hat Deutschland sich für einen Weg entschieden, der stark auf Energieimporten und einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien basiert.
Klimaziele: Beide Länder streben danach, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, allerdings auf unterschiedlichen Wegen. Die Nutzung der Kernenergie kann dazu beitragen, die Emissionen zu senken, indem sie eine konstante und zuverlässige Energiequelle bietet. Erneuerbare Energien bieten jedoch auch die Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren, besonders wenn die Netzinfrastruktur und Speichertechnologien weiterentwickelt werden.
Die Frage, welcher Ansatz aussichtsreicher ist, hängt stark von nationalen Prioritäten, ökonomischen Bedingungen und gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Während Großbritannien auf eine gemischte Strategie setzt, hat Deutschland sich klar für erneuerbare Energien entschieden. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und erfordern unterschiedliche politische, wirtschaftliche und technologische Anstrengungen, um ihre jeweiligen Energie- und Klimaziele zu erreichen.
Direkter Kostenvergleich der Energieerzeugungsarten
(vgl. Link Fokus)
Die Kosten für verschiedene Energieformen in Deutschland umfassen sowohl direkte Produktionskosten als auch Folgekosten, die sich auf Umwelt und Gesellschaft auswirken können. Hier eine Zusammenfassung der Kosten pro Kilowattstunde (kWh) für gängige Stromarten:
Nuklearenergie: 34 Cent pro kWh
- Produktionskosten: etwa 13 Cent
- Folgekosten: schwer abschätzbar, aber mindestens so hoch wie bei Braunkohle, insbesondere wegen der Herausforderungen bei der Endlagerung von Atommüll.
Braunkohle: 27 Cent pro kWh
- Produktionskosten: 6,3 Cent
- Folgekosten: 20,8 Cent, verursacht durch Umwelt- und Gesundheitsschäden sowie Treibhausgasemissionen.
Steinkohle: 27 Cent pro kWh
- Ähnliche Produktionskosten wie Braunkohle, jedoch etwas teurer in der Herstellung.
- Geringfügig günstigere Umweltfolgen als Braunkohle, aber zusätzliche langfristige Kosten durch die Sicherung ehemaliger Bergwerke.
Erdgas: 17 Cent pro kWh
- Niedrigere Produktionskosten, aber die Kosten verdoppeln sich fast durch Emissionen und Umweltfolgen.
Windenergie: 6 bis 11 Cent pro kWh
- Onshore-Anlagen: 6,1 Cent, wobei neuere Anlagen teilweise nur 4 Cent kosten.
- Offshore-Anlagen: Durchschnittlich 10,8 Cent.
- Geringe Folgekosten, hauptsächlich Umweltauswirkungen beim Bau.
Solarenergie: 9 Cent pro kWh
- Neue Solarparks erreichen Produktionskosten von 4 Cent, durchschnittlich sind es 7,6 Cent.
- Folgekosten durch Umweltauswirkungen beim Bau, jedoch insgesamt niedriger als bei fossilen Brennstoffen.
Diese Kostenaufstellung verdeutlicht, dass erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie tendenziell niedrigere Gesamtkosten und geringere Umweltauswirkungen aufweisen, während fossile Brennstoffe und Kernenergie höhere Folgekosten verursachen, die oft von der Gesellschaft getragen werden.
Links
- Pro Atomkraft https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-ein-jahr-atomausstieg--eu-setzt-dennoch-auf-atomenergie-100.html
- Kostenvergleich https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/atom-kohle-gas-wind-solar-welche-stromart-uns-am-wenigsten-kostet_id_11658454.html
- https://www.wiwo.de/unternehmen/energie/atomkraft-in-europa-was-kostet-atomstrom/29597204-3.html
Text: Blog-Team
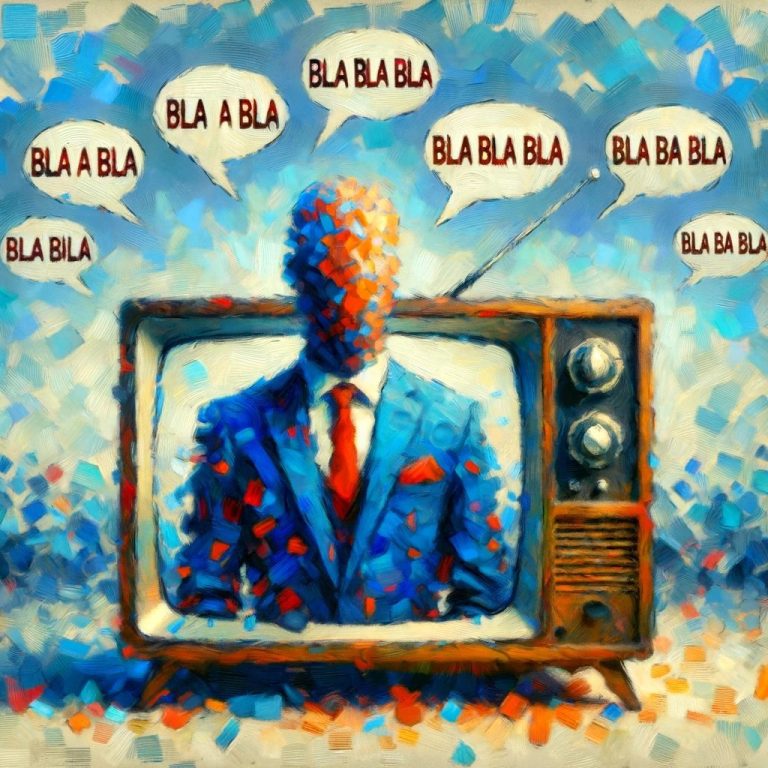
Das TV-Duell Höcke gegen Voigt
Das TV-Duell Höcke gegen Voigt
12.04.2024
Am Abend des 11. April 2024 erlebte Deutschland ein Fernsehereignis, das im Vorfeld bereits heftige Reaktionen hervorrief. Das angekündigte TV-Duell zwischen Björn Höcke, dem Spitzenkandidaten der thüringischen AfD, und Mario Voigt, einem eher unbekannten Politiker der CDU, versprach, polarisierend zu wirken. Im Vorfeld des Duells äußerten besorgte Bürger*innen und Mitglieder der Initiative "Gemeinsam für Brühl" in Mails ihre Bedenken an den Geschäftsführer von Welt TV/N24. Sie forderten ihn auf, das Duell nicht auszustrahlen, um der Verbreitung rechtsextremer Inhalte keinen Vorschub zu leisten.
Die Reaktion des Senders
In der Antwort des Senders wurde betont, dass das Ignorieren der AfD angesichts ihrer Umfrageergebnisse nicht funktioniere. Er argumentierte, dass eine kritische Konfrontation in einem Studio-Setting der richtige journalistische Ansatz sei. Er verteidigte die Entscheidung des Senders, das Duell auszustrahlen, mit der Absicht, die Aussagen der Teilnehmer kritisch zu hinterfragen.
Das Duell selbst
Die tatsächliche Austragung des Duells, berichtet von der Zeit, verlief anders als viele Kritiker*innen befürchteten. Es stellte sich heraus, dass die kritischen Fragen und die sachliche Moderation dazu beitrugen, die rhetorischen Schwächen Höckes aufzudecken. Mario Voigt, vorbereitet und besonnen, trat nicht nur als kritischer Gegner auf, sondern auch als Verfechter einer moderaten und durchdachten Politik. Dies stand im starken Kontrast zu Höckes oft polemischen und wenig substanzreichen Aussagen.
Die mediale Aufarbeitung
Das Duell, beworben als spannendes und herausforderndes Fernsehereignis, entpuppte sich als eine Gelegenheit, die Gefahren rhetorischer Hetze zu entlarven. Es zeigte, dass eine gut vorbereitete und faktengestützte Diskussion dazu beitragen kann, extremistische Positionen wirksam zu konterkarieren. Die Berichterstattung der Zeit hebt hervor, dass das Duell eine wichtige Nachricht lieferte: Es ist möglich, auch mit scharfen rechtsextremen Positionen sachlich umzugehen, wenn die Diskussion auf Fakten und fundierte Argumente gestützt wird.
Die Welt veröffentlichte nach dem Interview einen Faktencheck - siehe Links.
Links
- Video zum TV-Duell
https://www.youtube.com/watch?v=0LILBRMSIWc
- Faktencheck
https://www.welt.de/politik/deutschland/article250993092/TV-Duell-CDU-vs-AfD-Voigt-gegen-Hoecke-Harte-Aussagen-im-Faktencheck.html
- Auswertung TV-Duell
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024-04/tv-duell-bjoern-hoecke-mario-voigt-afd-cdu
Text: Blog-Team
Bild: KI
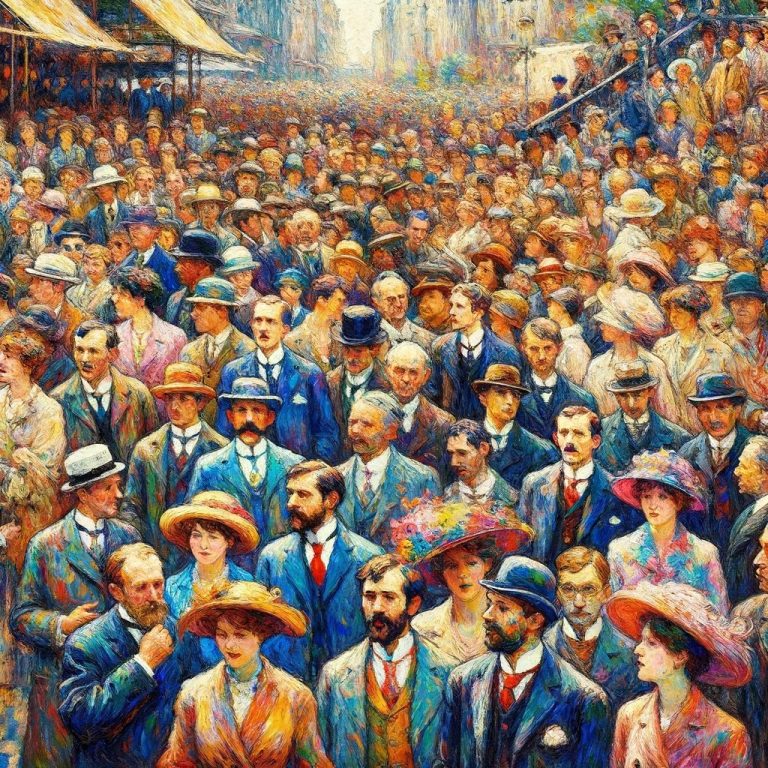
Wer wählt die AfD? Ein vielschichtiges Profil ihrer Wählerschaft
10.04.24
In der politischen Landschaft Deutschlands zeichnet sich die Alternative für Deutschland (AfD) durch ein stetiges Wachstum ihrer Wählerschaft aus. Drei Studien bieten einen detaillierten Einblick in das Profil der AfD-Anhänger: eine Analyse von ZEIT ONLINE, basierend auf Daten der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung und des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften, eine Untersuchung von Infratest dimap und eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Diese Studien decken auf, wer die AfD wählt, aus welchen sozioökonomischen Verhältnissen die Wähler kommen und welche Motive hinter ihrer Wahlentscheidung stehen.
Demografische Merkmale und politische Herkunft
Die Wählerschaft der AfD ist heterogener, als es gängige Klischees vermuten lassen. Obwohl Männer, Personen mittleren Alters und Bürger aus Ostdeutschland überrepräsentiert sind, finden sich unter den AfD-Wählern auch Frauen, jüngere Personen und Menschen aus dem Westen. Bildungsniveau und Einkommen variieren, wobei ein signifikanter Anteil der Wählerschaft mittlere bis höhere Bildungsabschlüsse und Einkommen aufweist.
Arbeitsbedingungen und sozioökonomische Sorgen
Die Studie des WSI zeigt, dass AfD-Wähler häufig über problematische Arbeitsbedingungen, mangelnde Anerkennung im Beruf und ein hohes Maß an Misstrauen gegenüber staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen berichten. Diese Gruppe ist besorgt über ihre wirtschaftliche Situation, die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die soziale Ungleichheit im Land. Stammwähler und potenzielle Neuwähler der AfD teilen viele Sorgen, obwohl sie sich in einigen Aspekten wie Bildung, Einkommen und politischen Themenprioritäten unterscheiden.
Migrationspolitik als zentrales Thema
Übereinstimmend betonen alle Studien die Bedeutung der Migrationspolitik für die AfD-Wählerschaft. Die ablehnende Haltung gegenüber Zuwanderung, einschließlich der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, ist ein wesentliches Merkmal, das die Wähler vereint. Diese Haltung wird nicht nur als Protest, sondern aus Überzeugung vertreten, wobei migrationskritische Positionen oft mit der Wahlentscheidung für die AfD korrelieren.
Politische Entfremdung und Misstrauen
Ein durchgängiges Merkmal der AfD-Anhänger ist eine tiefe Unzufriedenheit mit dem politischen System und den etablierten Parteien. Das Misstrauen reicht von der Bundesregierung über die Medien bis hin zu Polizei und Gerichten. Dieses Gefühl politischer und sozialer Entfremdung verstärkt die Neigung, populistischen und rechtsextremen Narrativen Glauben zu schenken.
Zurückgewinnung der Wählerschaft
Die Analyse der Wählerwanderung zeigt, dass demokratische Parteien durchaus Chancen haben, entfremdete Wähler zurückzugewinnen, indem sie soziale und finanzielle Sorgen ernst nehmen und adressieren, ohne auf migrationsfeindliche Rhetorik zurückzugreifen. Eine Politik, die sich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen konzentriert und dabei eine offene und demokratische Gesellschaft verteidigt, könnte einen Weg aufzeigen, Teile der AfD-Wählerschaft für das demokratische Spektrum zurückzugewinnen.
Links
- https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024-03/afd-waehler-profil-daten-statistik
- https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/afd-waehler-herkunft-profil-und-motivation/
- https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-studie-leuchtet-anstieg-der-afd-wahlbereitschaft-aus-54087.htm
Text: Blog-Team
Bild: KI

Friedliche Protestaktion gegen einen AfD-Stand in Brühl
05.04.24
Am Freitagmorgen fand in Brühl eine friedliche Protestaktion gegen einen Informationsstand der Alternative für Deutschland (AfD) statt. Die Versammlung, die von der Initiative "Gemeinsam für Brühl" organisiert wurde, zog etwa 50 Teilnehmende an. Unter den Anwesenden befand sich auch eine Gruppe junger Menschen vom OAT Köln, die nach Brühl gekommen waren, um den Protest zu unterstützen.
Die Aktion stieß auf ein lebhaftes Echo unter den Passanten. Viele blieben stehen, um sich zu informieren oder um Diskussionen mit den Protestierenden zu führen. Während die meisten Reaktionen positiv ausfielen, gab es auch kritische Stimmen, insbesondere von Personen, die Sympathien für die AfD zeigten. Trotz der teilweise emotional geführten Gespräche blieb die Atmosphäre insgesamt friedlich.
Der AfD-Stand selbst schien während der Protestaktion nur wenig Aufmerksamkeit von Passanten zu erhalten.
Ein weiteres positives Ergebnis der Aktion war die Erweiterung der Telefonkette von "Gemeinsam für Brühl" und der Zusage einer Passantin, bei zukünftigen Aktionen weitere Unterstützer aus ihrem Umfeld mobilisieren zu wollen.
Ein Vorschlag zur Verbesserung der Wirkung der Protestplakate wurde ebenfalls aufgegriffen. Um Missverständnisse zu vermeiden, soll künftig klarer kommuniziert werden, dass die Initiative "Gemeinsam für Brühl" entschieden gegen die AfD steht.
Dies soll durch zusätzliche Slogans wie „Rote Karte für die AfD“ auf den Plakaten unterstützt werden.
Text: Blog-Team
Bild: Ra-We

Instagram @gemeinsamfuerbruehl
Neu auf Instagram: @gemeinsamfuerbruehl
06.04.2024
Wir bringen die Bewegung #GemeinsamFürBrühl jetzt auch auf Instagram! 📱💫 Folgt uns, um Teil einer starken Gemeinschaft zu werden, die sich für den Schutz unserer demokratischen Werte einsetzt – in Brühl und überall. 🏡🌍
Wer wir sind? Eine Gruppe engagierter Bürger:innen, vereint durch die Brühler Erklärung aus der Pandemiezeit. Uns treibt der Wunsch an, Solidarität, Respekt und Demokratie zu leben und zu verteidigen. 💖🛡️
Unser Ziel? Wir wollen eine Plattform bieten, auf der wir uns austauschen, unterstützen und gemeinsame Aktionen planen können. Egal ob du Ideen hast, aktiv mitwirken oder einfach nur dabei sein möchtest – hier bist du richtig! 🤝✨
Sei dabei! Folge @gemeinsamfuerbruehl, um Updates zu erhalten, dich zu engagieren und mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Lass uns gemeinsam für ein solidarisches und demokratisches Brühl einstehen!
Link zu Instagram
Text: Blog-Team
Bild: KI

Europawahlprogramm der AfD:
Ein Schritt zurück für Deutschland?
06.04.24
In der politischen Landschaft Europas nehmen nationalistische und protektionistische Tendenzen wieder zu. Besonders auffällig ist dies im Wahlprogramm der Alternative für Deutschland (AfD) zur Europawahl, das Deutschland angeblich zurück zu alter Souveränität führen soll. Doch ein genauerer Blick lässt erahnen, dass dieses Versprechen in der heutigen globalisierten Welt eher Schaden als Nutzen bringen würde.
Der Traum von Souveränität und die Realität der Globalisierung
Das zentrale Versprechen der AfD, die Wiederherstellung der deutschen Souveränität, klingt verlockend. Wer möchte nicht, dass sein Land selbstbestimmt agiert? Doch in einer Welt, die zunehmend vernetzt und interdependent ist, stellt sich die Frage, ob eine solche Rückbesinnung auf den Nationalstaat tatsächlich im Interesse Deutschlands liegt. Der Fall Brexit zeigt deutlich, dass der Versuch, allein mehr Souveränität zu erlangen, schnell in eine Sackgasse führen kann. Vier Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist die Bilanz ernüchternd: Wirtschaftlicher Schaden, politische Isolation und ein Anstieg der Einwanderung, den man eigentlich reduzieren wollte【1】.
Protektionismus und die Bedrohung der Freizügigkeit
Die Alternative für Deutschland (AfD) fordert, bis zur "Wiederherstellung der deutschen Souveränität über unsere Grenzen" eine Notifizierung der deutschen Binnengrenze bei der EU-Kommission einzureichen. Auf den ersten Blick mag dieser Vorschlag für einige attraktiv erscheinen, da er Souveränität und Kontrolle betont. Doch die Umsetzung protektionistischer Maßnahmen wie Einreiseeinschränkungen, Einfuhrkontrollen und Zölle birgt langfristige Risiken, die weit über die Wirtschaft hinausgehen und die persönliche Freiheit jedes Einzelnen betreffen.
Wirtschaftliche Folgen des Protektionismus
Protektionismus führt zu wirtschaftlicher Isolation. Durch die Einführung von Handelsbarrieren und Grenzkontrollen würden die Kosten für importierte Waren steigen, was unmittelbar die Verbraucher trifft. Unternehmen, die auf den Export angewiesen sind, würden ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verlieren, was zu Jobverlusten und einer Schwächung der Wirtschaft führen könnte. Die Geschichte hat gezeigt, dass Länder, die sich abschotten, selten langfristigen Wohlstand genießen.
Einschränkung der Freizügigkeit
Ein oft übersehener Aspekt des Protektionismus wäre eine Einschränkung der Freizügigkeit, die ein Grundpfeiler der Europäischen Union ist. Die Möglichkeit, frei zu reisen, zu arbeiten und zu leben, wo man möchte, hat das Leben vieler Europäer bereichert. Grenzkontrollen und Einschränkungen würden diese Freiheiten gefährden.
Vorstellungen wie spontane Wochenendtrips nach Frankreich, Studienaufenthalte in Spanien oder Shoppingtouren in Holland könnten der Vergangenheit angehören. Die Freizügigkeit ermöglicht es uns, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, andere Kulturen kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Sie fördert das Verständnis und den Zusammenhalt innerhalb Europas und bildet die Basis für eine offene, vielfältige Gesellschaft.
Die Wirtschaft warnt
Nicht nur politische Beobachter, sondern auch die Wirtschaft selbst äußert sich zunehmend besorgt über die Ausrichtung der AfD. Wirtschaftsbosse und -experten warnen vor den Gefahren, die eine potenzielle AfD-Regierung für den Standort Deutschland bedeuten könnte. Von Jobverlusten bis hin zu einem Rückgang internationaler Investitionen – die Risiken sind vielfältig【3】【4】. Christian Sewing, Vorstandschef der Deutschen Bank, betont, dass rechtspopulistische Tendenzen "nicht nur die Gesellschaft spalten, sondern auch direkt in den wirtschaftlichen Abstieg führen" würden【5】.
Der Brexit sollte eine Mahnung sein, dass der Rückzug in den Nationalstaat und die Abkehr von gemeinsamen Werten und Märkten keine Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit bietet. Deutschland profitiert enorm von seiner Einbettung in die Europäische Union – wirtschaftlich, politisch und kulturell.
Deutschland braucht eine Politik, die auf Offenheit, Vielfalt und internationale Zusammenarbeit setzt.
Links und Quellen
- "Vier Jahre Brexit: Die Bilanz für Großbritannien ist verheerend" - Capital
- Auszug aus dem Europa-Wahlprogramm 2024 der AfD (wird hier nicht verlinkt, ist aber leicht zu finden)
- "AfD: Warum Wirtschaftsexperten vor der Ökonomie der Rechten warnen" - Stern
- "Wirtschaft hält AfD für ein Risiko" - FAZ
- "Deutsche-Bank-Chef: AfD-Pläne sorgen für 'wirtschaftlichen Abstieg'" - Fonds Professionell
Text: Blog-Team
Bild: KI
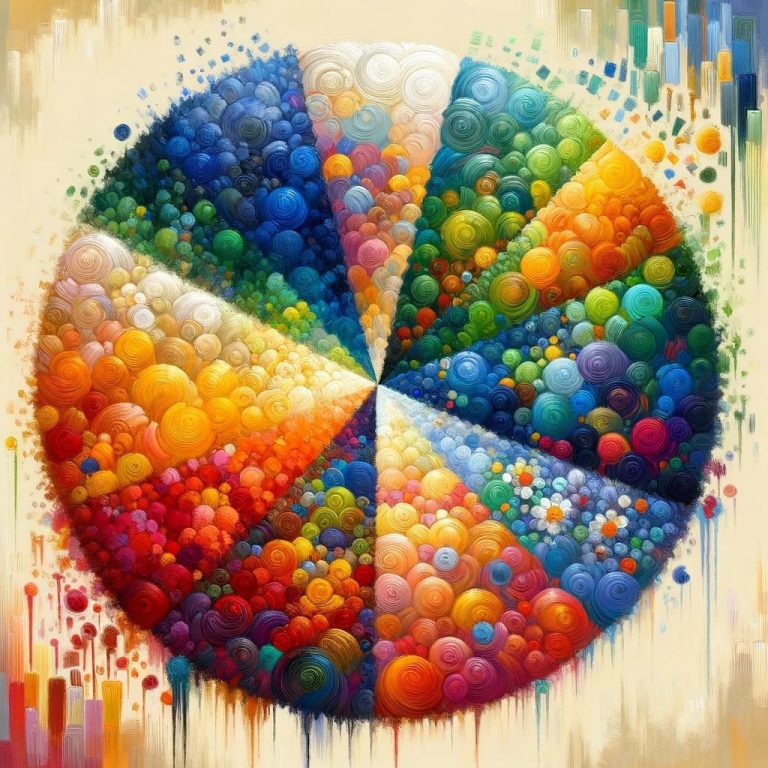
DIHK aktualisiert Logo als Ausdruck gegen Ausgrenzung:
"27 Prozent von uns"
03.04.2024
Im Zuge einer Kampagne zur Hervorhebung der Bedeutung von Menschen mit Migrationshintergrund in der deutschen Wirtschaft hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) entschieden, ihr Logo temporär zu ändern.
Diese Aktion trägt den Titel "27 Prozent von uns - #KeineWirtschaftOhneWir" und zielt darauf ab, ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Wertschätzung der Diversität am Arbeitsplatz zu setzen. DIHK-Präsident Peter Adrian unterstreicht die essenzielle Rolle von Menschen mit Migrationsgeschichte für die deutsche Wirtschaft und die Notwendigkeit, diese Gruppe stärker in den Fokus zu rücken.
Ein Blick auf die Stadt Brühl zeigt, wie aktuell und wichtig diese Kampagne ist. Dort leben Menschen aus verschiedenen Kulturen Seite an Seite.
Die Integrationskennzahlen aus Brühl veranschaulichen die Komplexität der Thematik: Während der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen über 28% liegt, zeigen die Zahlen bei der Schulbildung und auf dem Arbeitsmarkt, dass hier noch Handlungsbedarf besteht. Besonders auffällig ist der hohe Ausländeranteil an Hauptschulen und die niedrige Quote ausländischer Kinder an Gymnasien, was die Zugänglichkeit zu höherer Bildung und besseren beruflichen Chancen für diese Gruppe limitiert.
Vielfalt und Inklusion sind keine Option, sondern eine Notwendigkeit für den Erhalt und die Förderung des deutschen Wohlstands.
Links
- https://www.tagesschau.de/wirtschaft/dihk-logo-gegen-rassismus-100.html
- https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsbericht2021/PersonenMigrationshintergrund/personenmigrationshintergrund-node.html
- https://www.bruehl.de/auswertung-integrationsmonitoring-vom-20.02.2010.pdfx
Text: Blog-Team
Bild: KI

Risiken des Erreichen von Kippunkten verdeutlicht
Würden Sie in ein Flugzeug steigen, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent abstürzt?
03.04.24
Im Podcast "Würden Sie in ein Flugzeug steigen, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent abstürzt?" führt uns Klima- und Meeresforscher Stefan Rahmstorf in das Thema Klimakipppunkte ein. Mit verständlichen Analogien und klaren Erklärungen legt Rahmstorf dar, warum bestimmte Veränderungen im Klimasystem nicht mehr rückgängig zu machen sind, sobald sie einmal in Gang gesetzt wurden. Er illustriert, wie das Kippen der Atlantikströmung, das Abschmelzen großer Eismassen und die Zerstörung des Amazonaswaldes zu solchen irreversiblen Veränderungen führen könnten, deren Folgen die Dimension des aktuellen Klimawandels übersteigen.
Rahmstorf betont die Wichtigkeit des präventiven Handelns, um diese Kipppunkte zu vermeiden, und erläutert, dass einmal überschrittene Grenzen des Klimasystems nicht mehr zurückgenommen werden können. Rahmstorf vergleicht das Eingehen der Risiken des Erreichen von Kippunkten, die im IPPC-Bericht als "unwahrscheinlich" angegeben werden, mit der individuellen Entscheidung, in ein Flugzeug zu steigen, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent abstürzt – eine Perspektive, die die Dringlichkeit des Handelns unterstreicht.
Link
Text: Blog-Team
Bild: KI
Video
Harald Lesch, 27.03.24
1. Der Klimawandel ist real
2. Wir sind die Ursache
3. Er ist gefährlich und
4. die Fachleute sind sich einig
5. wir können noch was tun
bei 13:43 min von 41 min
Die 5 Thesen generiert Lesch mit Bezug auf dieses Papier:
https://www.klima-allianz.de/fileadmin/user_upload/2021_und_aelter/Klima_Manifest_Klima-Allianz-Deutschland.pdf
Video gefunden: Blog-Team
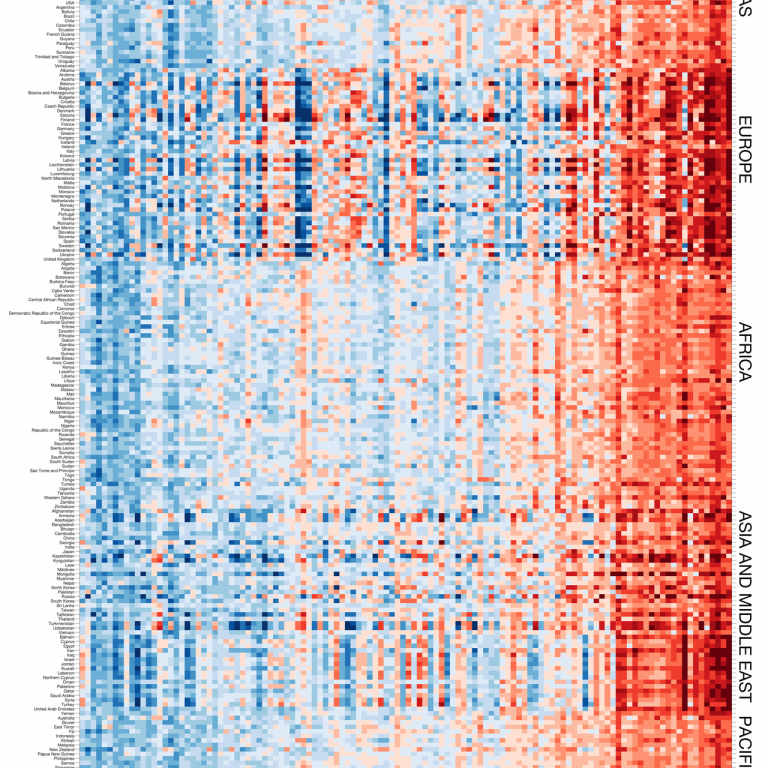
IPCC Synthesebericht 2023
29.03.2024
Die Argumentation der Kritiker ist u.a., dass bzgl. des Klimawandels Panik betrieben wird, dass Computermodelle verwendet werden ohne dass diese die realen Ergebnisse vorausahnen können und dass nicht alle Wissenschaftler gehört werden und eine Bühne bekommen. Deutschland könne ohnehin nichts ändern und die Klimapolitik der Bundesregierung sei überzogen.
Dagegen kann man den IPCC-Bericht stellen, der von weltweit ausgewählten Spezialisten ausgearbeitet wurde und eine nüchterne Gesamtübersicht über die Lage bietet:
Der Synthesereport „Climate Change 2023“ des Sechsten Sachstandsberichts der IPCC wurde am 20. März 2023 auf einer Pressekonferenz im schweizerischen Interlaken vorgestellt. Am Abschlussbericht haben 93 Wissenschaftler:innen mitgewirkt, zwei davon aus Deutschland. Er bündelt die Erkenntnisse der letzten Jahre zum Klimawandel und ist eine Zusammenfassung der sechs Berichte, die seit 2018 erschienen sind. Bei der Vorstellung des Berichts warnte UN-Generalsekretär António Guterres:
„Die Klima-Zeitbombe tickt. Aber der heutige IPCC-Bericht ist ein Leitfaden zur Entschärfung der Klima-Zeitbombe. Er ist ein Überlebensleitfaden für die Menschheit.“
1,5-Grad-Ziel kaum noch zu erreichen
Schon 2018 machte der IPCC deutlich, dass enorme Anstrengungen vonnöten seien, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Nun, fünf Jahre später, sei die Herausforderung immens. Es bleibe keine Zeit mehr und man müsse sofort handeln, so die Wissenschaftler:innen. Die bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel seien zu wenig ambitioniert und weitreichend; überdies würden die Regierungen zu langsam agieren. Findet hier nicht ein sofortiges weltweites Umdenken und entschlossenes Handeln statt, wird die Erde sich bereits in den 2030er-Jahren um 1,5 Grad erwärmt haben. Aktuell liegt die Erwärmung bereits bei 1,1 Grad. Dies führt schon jetzt zu immer häufigeren und intensiveren Extremwetterereignissen, die immer gefährlichere Auswirkungen auf die Natur und den Menschen in allen Regionen der Welt haben.
Klimawandel trifft die Schwächsten
Die Folgen des Klimawandels würden die schwächsten Menschen und Ökosysteme am härtesten treffen, so der IPCC. Daher sei „Klimagerechtigkeit [...] von entscheidender Bedeutung, denn diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, sind unverhältnismäßig stark betroffen“.
Treibhausgasemissionen müssen ab sofort sinken
Die Forderung der Wissenschaft: Die globalen Treibhausgasemissionen müssen ab sofort in allen Sektoren sinken und bis 2030 halbiert werden, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Außerdem richtet der Bericht einen Appell an die Regierungen weltweit, die Finanzierung von Klimainvestitionen massiv zu erhöhen.
Klimaschutz als Chance
Für die Klimaexpert:innen liegt die Lösung in einer klimaresilienten Entwicklung. So können Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion gepaart mit Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels langfristig für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft sorgen. Denn Klimaschutzmaßnahmen würden nicht nur die Schäden für Mensch und Natur verringern, sondern könnten auch die Wirtschaft ankurbeln und die Gesundheit verbessern. „Wenn wir jetzt handeln, können wir noch eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle sichern“, sagte der IPCC-Vorsitzende Hoesung Lee.
Links
- https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
- Kommentar DLF
https://www.deutschlandfunk.de/kommentar-zum-weltklimarat-bericht-ein-mutmacher-und-dokument-des-schreckens-dlf-3f36c6d8-100.html - https://de.wikipedia.org/wiki/Klimastreifen
Text: Blog-Team
Bild: Ed Hawkins, climate scientist at University of Reading - Hawkins, Ed, #ShowYourStripes. Climate Lab Book (21 July 2019). Archived from the original on 2 August 2019. "LICENSE / Creative Commons License / These blog pages & images are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License."
Protest gegen die Aktion der "Freiheitsboten"
25.03.24
Am 23. März 2024 versuchten die "Freiheitsboten Brühl und Wesseling" in Brühl mit einer "Galerie der Aufklärung" für ihre Thesen zu werben, stießen aber auf Widerstand. Zeitweise stellten sich zwischen 70 und 100 Gegendemonstrant*innen aus diversen demokratischen Initiativen gegen die von den vermeintlichen Freiheitsboten getragenen oftmals verkürzten Botschaften.
Eine besondere Rolle spielte dabei die "Galerie der Richtigstellung", die als faktenbasierte Gegenposition zu den verbreiteten Desinformationen diente. Der breite Protest zeigte, wie wichtig ein überregionales Netzwerk demokratischer Kräfte zum Erhalt der Stabilität unserer Demokratie ist.
Mehr dazu im
Artikel vom 25.03.24 im Brühler Schlossboten:
Und im Artikel vom 24.03.24 im Kölner Stadtanzeiger (Paywall)
Text Blog-Team
Bild: Fifi vor der Wäscheleine des Grauens (Menschen wurden absichtlich nachträglich ausgeblendet) - Blog-Team


Zur Galerie der Richtigstellung
23.03.24
Tauche ein in die Welt der Aufklärung mit unserer "Galerie der Richtigstellung". In einer Zeit, in der Desinformation und Verschwörungsmythen allgegenwärtig zu sein scheinen, bieten wir dir einen Leuchtturm der Klarheit. Inspiriert von der Brühler Erklärung, stehen wir für Solidarität, Respekt und die Werte der Demokratie. Wir laden dich herzlich ein, mit uns und den Unterzeichnern der Brühler Erklärung auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Gemeinsam decken wir die Fakten hinter den Mythen auf und treten für eine Welt ein, die auf Solidarität und demokratischen Prinzipien beruht. Bereite dich vor auf eine Reise der Aufklärung. Viel Freude beim Lesen und Entdecken in unserer Galerie!
Unbeirrt durch Regen:
"Wir sind Brühl! Für Demokratie, Vielfalt und Respekt."
Brühler*innen setzen Zeichen für Vielfalt und Demokratie
Am 15. März 2024 bewiesen die Brühler*innen, dass wahre Entschlossenheit und Zusammenhalt auch durch heftigen Regen nicht zu erschüttern sind. Etwa 1300 engagierte Menschen kamen zusammen, unterstützt von einem breiten Bündnis aus demokratischen Parteien, Initiativen und Gruppen, um ein kraftvolles Signal für Vielfalt und Demokratie auszusenden.
Der Demonstrationszug, der durch die nassen Straßen Brühls führte, war ein lebendiges Zeugnis der Standhaftigkeit der Teilnehmer*innen. Viel Aplaus erntete der berührende und inspirierende Beitrag von Amin Aarween, einem Journalisten, der vor den Taliban geflohen ist. Seine leidenschaftliche Sorge um die Demokratie in seiner neuen Heimat berührte die Herzen vieler.
Ein weiteres Highlight des Abends stellten die Reden der Schülerinnen und Schüler verschiedener Brühler Schulen dar. Ihre pointierten und kraftvollen Worte zum Thema Demokratie und Vielfalt fanden breiten Anklang und wurden mit reichlich Beifall gewürdigt. Diese jungen Stimmen symbolisierten nicht nur die Hoffnung und das Engagement der neuen Generation, sondern machten auch deutlich, dass ihre Perspektiven und Stimmen essentiell für die Zukunft und Stärkung demokratischer Werte sind.
Neben Amin Aarween und den beeindruckenden jungen Redner*innen der Schülervertretungen, wurde der Abend auch durch die künstlerischen Beiträge von Matthias Petzold und Andi Reisner bereichert, die mit ihrer jazzigen Musik für Atmosphäre sorgten. Müller & Major brachten mit ihrer Kölsch-Brühler-Mundart lokale Kultur zum Ausdruck, während Andreas Roos als Singer-Songwriter tiefgründige Akzente setzte. Die Irish Folk Gruppe Celtic Fire und die Brühler Rockröhre Nina Anders mit ihrem Chor Cansing trugen mit ihren Stücken zu einer einzigartigen und inspirierenden Stimmung bei.
Unter der Moderation von Susanne Bourier, die das Publikum durch einen Abend voller tiefgreifender Einsichten führte, wurde deutlich, dass die Gemeinschaft Brühls in ihrer Vielfalt und ihrem Engagement vereint ist.
In seiner Ansprache hob Bürgermeister Dieter Freytag die herausragende Bedeutung des Themas hervor und betonte nachdrücklich die entscheidende Rolle des gemeinschaftlichen Engagements für Demokratie und Vielfalt.
Weitere Fotos sind in unserem "Blog" auf dieser Seite zu finden: Link zum GfB Blog
Text: Blog-Team
Fotos: WK, KS


Impressionen von der Demo 15.03.2024 in Brühl
Wir sind Brühl! Für Demokratie, Vielfalt und Respekt
15.03.2024
Der Himmel öffnete seine Schleusen, doch das hielt die Brühler*innen nicht davon ab, für ihre Überzeugungen auf die Straße zu gehen. Unerschütterlich trotzen sie dem Regen, um an der Demonstration teilzunehmen. Etwa 1300 Menschen versammelten sich, entschlossen, ein deutliches Signal für die Bedeutung von Vielfalt und Demokratie zu senden.
Bilder: verschiedene Quellen (vielen Dank!)
Text: Blog-Team
Rede der Schüler*innenvertretung
Bei der Kundgebung am 15.03.2024 haben Schüler*innen der weiterführenden Schulen in Brühl gemeinsam eine beeindruckende Rede gehalten, die wir hier noch einmal zum nachlesen posten möchten.
Liebe Brühlerinnen und Brühler,
wir stehen hier als Schülersprecher fast aller weiterführenden Schulen Brühls, um gemeinsam für die Demokratie, die Vielfalt und den Respekt in unserer Gesellschaft einzustehen. Denn wir alle haben Angst davor, wie unsere Zukunft aussehen würde, wenn wieder einmal rechtsextreme Gruppen und Parteien wie die AfD an die Macht gelangen. Denn das, was die AfD plant, würde uns junge Menschen besonders betreffen:
Die AfD stellt den menschengemachten Klimawandel in Frage und lehnt damit auch das Ziel der Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 ab. Die gravierenden Auswikrungen des Klimawandels, die jetzt schon in Deutschland, Europa und der gesamten Welt spürbar sind, würden zunehmen - die AfD würde nichts gegen die Zerstörung unserer aller Lebensgrundlage tun. Aber noch viel wichtiger für uns: Die AfD lehnt eine vielfältige Gesellschaft klar und deutlich ab. Sie plant, im Geheimen, Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben, die laut der AfD nicht ausreichend angepasst sind, auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
- Genau diese Vielfalt, die Vielfalt an Religionen, Nationalitäten, Weltanschauungen, sexuellen Orientierungen und Identitäten ist das, was uns hilft, die Welt zu verstehen. Vielfalt zeigt uns verschiedene Kulturen und neue Perspektiven, die uns ermöglichen, die Welt anders und viel bunter zu sehen. Wenn wir Vielfalt als die Realität ansehen, die sie in Deutschland ist, können wir die Gesellschaft gemeinsam neugestalten und entwickeln, damit sich die nächsten Generationen mit und ohne Migrationshintergrund nicht für die Person, die sie sind, schämen oder vor der Gesellschaft verstecken müssen. Ohne Veränderung oder Unterschiede steht die Welt still. Wir wollen keine eintönige Gesellschaft, sondern eine, die uns viele verschiedene Türen offenhält, ob Deutsch oder nicht.
Und genau dieses Versprechen, haben wir in den letzten Jahrzehnten den Menschen gegeben, die hier hin geflohen sind, so wie meinem Vater, einem Großteil meiner Familie und vielen weiteren aus dieser Gesellschaft. Sie haben ihr Land verlassen oder sind aus ihrem Land geflohen, um hier in Deutschland sicher zu sein und die Chance auf ein neues, besseres Leben zu bekommen. Wenn die Rechtsextremen an die Macht kommen, wird die Sicherheit und die Akzeptanz, die Deutschland ihnen versichert hat, zerstört.
Jeder hier kennt bestimmt mindestens einen, der nicht deutscher Herkunft ist, ob Familie, Freunde, Mitschüler, Lehrer, Partner oder man selbst. Sie und wir alle haben das Recht, hier zu sein und ein sicheres Leben in Akzeptanz zu führen. Ich möchte nicht, dass meine Familie sich hier nicht mehr willkommen fühlt oder anders behandelt wird. Auf persisch heißen die Wörter: sendegi und azadi, Leben und Freiheit. Lasst uns alle in Freiheit leben und die große Vielfalt in Deutschland beibehalten. Kultur macht die Welt bunt. Wir alle machen die Welt bunt, also lasst und dafür sorgen, dass rechtsextreme Gruppen uns diese Farben nicht wegnehmen.
- Mein Name ist Mohammed [...], ich komme aus Syrien und bin seit 2015 hier in Deutschland. Ich und viele andere Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern mussten unsere Heimat verlassen, weil dort Krieg herrscht und wir uns dort nicht mehr sicher fühlten. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass ihr uns in eurem Land so herzlich aufgenommen habt. Wir fühlen uns hier sicher und sind euch allen sehr dankbar dafür, dass hier so viel Menschen stehen um mit uns gegen Rechts kämpfen. Ich und viele andere Geflüchtete hoffen auf ein besseres Leben, wollen hier eine Zukunft aufbauen und in Frieden gemeinsam mit euch leben. Wenn Rechtsextreme an die Macht kommen, sind Flüchtlinge hier nicht mehr willkommen. Wir werden uns hier nicht mehr sicher fühlen und werden wir sogar abgeschoben. Deutschland ist und soll bunt bleiben.
- Um genau diese Vielfalt in Deutschland beizubehalten, brauchen wir weiterhin eine Demokratie, in der wir die Möglichkeit haben, unsere Stimmen zu erheben und an den Entscheidungen teilzuhaben, die unser eigenes Leben unsere Gesellschaft betreffen - so wie wir alles es jetzt tun. Es ist das Fundament unserer Freiheit und ermöglicht uns, gemeinsam an der Gestaltung einer gerechten und inklusiven Gesellschaft mitzuwirken. Die Vergangenheit zeigt uns eindrücklich, dass die Abschaffung einer Demokratie auch mit demokratischen Mitteln geschehen kann und wird, wenn sich Menschen dem nicht widersetzen. Von den Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus zu den Menschen, die die Demokratie in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg aufgebaut haben war viel Arbeit, Wille und Mut notwendig, um unsere demokratische Gesellschaft zu erreichen. Denken wir einmal daran, wie viele Leute für unsere Rechte gekämpft haben, die wir heute so selbstverständlich finden. Mutige Menschen haben enormen Einsatz gezeigt und persönliche Opfer gebracht, damit wir heute in einer Demokratie leben können. Wir schulden es ihnen, ihr Erbe zu ehren und dafür zu kämpfen, dass unsere Gesellschaft weiterhin so vielfältig und demokratisch bleibt. Lasst uns ihre Leidenschaft und ihren Mut als Antrieb nutzen, um unsere Stimme zu erheben und für das einzutreten, woran sie geglaubt haben. Ihre Opfer und ihr Durchhaltevermögen in dunklen Zeiten erinnern uns daran, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist und dass wir stets wachsam sein müssen, um sie zu verteidigen.
- Die Demokratie zu verteidigen können wir aber nur als Gesellschaft, die zusammenhält. Die AfD möchte diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht, sie spaltet, hetzt gegen Minderheiten und schürt Angst und Hass. Um dies zu verhindern, erwarten wir von uns selbst und jedem hier, für diesen Zusammenhalt einzustehen. Das schaffen wir, indem man sich engagiert, wählen geht und am öffentlichen Leben teilnimmt. Aber von der Politik erwarten wir diesen Einsatz auch: Wer Feindbilder erzeugt und Menschen gegeneinander ausspielt, wer Falschnachrichten streut und auf komplexe Fragen zu einfache Antworten gibt, spielt populistischen Bewegungen wie der AfD in die Karten. Denn die globalen Probleme, wie Migration, Klima und Ungleichheit, lösen wir nur, wenn wir zusammenarbeiten, über Ländergrenzen hinweg. Indem wir Verständnis zeigen für andere Perspektiven und wegkommen von Stereotypen über Mann und Frau, von Deutschen und Nicht-Deutschen. Es ist unser aller Aufgabe, Respekt und Toleranz allen Menschen zu gewähren und dies stets in jeder unserer Handlungen mit einzubeziehen. Und dafür stehen wir hier oben. Danke sehr!
Herzlichen Dank an Roya, Jill, Nuray, Timur und Mohammed für diese wunderbare Rede, die uns alle sehr bewegt hat!
Rede des afghanischen Journalisten Amin A.
Bei unserer Kundgebung am 15.03.2024 hat u.a. der afghanische Journalist Amin A., der als Ortskraft nach Deutschland kam, eine bewegende Rede gehalten, die wir hier noch einmal zum nachlesen posten möchten.
Meine Flucht aus Afghanistan, auf der Suche nach Integration in Deutschland und Angst vor der AFD
Mein Name ist Amin A.. Ich komme aus Afghanistan und ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich habe Journalismus studiert und lange als Journalist für die deutsche Bundeswehr in meiner Heimat gearbeitet. Seit zwei Jahren und zwei Monaten bin ich in Deutschland. Momentan wohne ich in Brühl, arbeite ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe bei der Stadt Brühl und besuche ich einen C1-Berufs-Deutschkurs.
Während der zwei Jahre, die ich in Deutschland lebe, habe ich sehr nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt, die mir dabei geholfen haben, die Sprache zu lernen, eine Wohnung zu finden, die sehr gute Tipps geben und mir dabei helfen, meinen eigenen Weg zu einem Beruf zu finden. Ich bin froh, dass ich in Sicherheit bin ohne Angst vor den Taliban und vor Gewalt.
Meine Tochter könnte nicht zur Schule gehen, wenn sie heute in Afghanistan wäre. Aber hier kann sie zur Schule gehen und in Sicherheit leben. Ich habe Angst, nachdem die AfD angekündigt hat, dass sie die Einwanderer von hier ausweisen wird, wenn sie an die Macht kommen würde.
Die Vorstellung, dass ich selbst einmal als Flüchtling unter so einer Regierung wie einer AfD-Regierung leben müsste, macht mir Sorgen. Ich habe Angst, dass Beamte eines Nachts unangekündigt vor meiner Tür stehen und mich in ein Flugzeug nach Afghanistan setzen könnten. Was würde mit mir und meiner Familie passieren, wenn die AfD mich nach Afghanistan abschiebt? Ich habe auch Angst vor den Taliban, weil sie auch meine Feinde sind.
Als Flüchtling möchte ich heute meine Stimme erheben, nicht gegen eine bestimmte politische Partei, sondern für Werte, die uns alle verbinden sollten – Solidarität, Toleranz und Vielfalt.
In einer Welt, die von Vielfalt geprägt ist, können wir nur gemeinsam vorankommen. Lasst uns Brücken bauen, anstatt Mauern zu errichten. Unabhängig von politischen Überzeugungen sollten wir uns für eine Gesellschaft einsetzen, die jedem Einzelnen eine Chance gibt und auf den Prinzipien der Menschlichkeit basiert.
Lasst uns gemeinsam gegen Ausgrenzung kämpfen und für eine Zukunft stehen, in der wir Hand in Hand gehen – unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung.
Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Vielfalt als Stärke betrachtet wird und in der jede Stimme zählt. Wir stehen heute gemeinsam hier, um unsere Stimmen gegen jede Form von Diskriminierung und für eine inklusive und bunte Gesellschaft zu erheben. Die AfD propagiert eine Politik, die auf Spaltung und Ausgrenzung basiert. Doch wir glauben an Demokratie, Solidarität, Toleranz und Respekt.
Lasst uns vereint für eine Zukunft eintreten, in der Vielfalt als Stärke betrachtet wird. Gemeinsam können wir eine Gesellschaft gestalten, die auf Gleichheit und gegenseitigem Verständnis beruht. Zeigen wir, dass wir für eine offene Zukunft stehen, in der jede Stimme gehört wird.
Herzlichen Dank an Amin A. für die offene und berührende Rede!
Die verschiedenen Abstufungen von "Rechts"
18.03.2024
Politisch rechts: In Bezug auf Migration vertreten Menschen mit politisch rechten Ansichten oft eine restriktive Einwanderungspolitik, die auf der Kontrolle der Grenzen und der Förderung der nationalen Identität basiert. Sie können für eine stärkere Betonung der nationalen Souveränität und die Wahrung kultureller Traditionen eintreten. In ökologischen Fragen stehen sie möglicherweise für eine weniger interventionistische Umweltpolitik und betonen wirtschaftliche Interessen über Umweltschutzmaßnahmen. Ihre Ansichten zu den "Mainstream-Medien" können kritisch sein, wobei sie häufig den Vorwurf erheben, dass diese Medien eine liberale oder linksgerichtete Agenda verfolgen und alternative Quellen bevorzugen, die ihre eigenen Überzeugungen unterstützen.
Rechtsextrem: Rechtsextreme Ansichten zu Migration sind oft von rassistischem oder ethnisch-nationalistischem Gedankengut geprägt und können zu extremistischen Handlungen gegen Migranten oder Minderheiten führen. Sie setzen sich möglicherweise für die Schaffung einer ethnisch homogenen Gesellschaft ein und lehnen jegliche Form von Multikulturalismus ab. In ökologischen Fragen können rechtsextreme Gruppen Umweltschutz als sekundär betrachten und nationalistische Interessen über Umweltbelange stellen. Sie neigen dazu, "Mainstream-Medien" als Teil einer angeblichen Verschwörung zu betrachten, die ihre Ideen unterdrückt, und verlassen sich stattdessen auf extremistische Propaganda und Desinformation.
Rechtsradikal: Rechtsradikale Positionen zu Migration gehen oft mit xenophoben und fremdenfeindlichen Ansichten einher, die zu rassistischer Diskriminierung und Gewalt führen können. Sie befürworten häufig eine starke Abschottungspolitik, die Einwanderung begrenzt und ethnische oder religiöse Minderheiten als Bedrohung für die nationale Identität ansieht. In ökologischen Fragen können rechtsradikale Ansichten anthropozentrisch sein und den Umweltschutz zugunsten wirtschaftlicher Interessen vernachlässigen. Rechtsradikale tendieren dazu, "Mainstream-Medien" als feindlich gegenüber ihren Ideologien zu betrachten und sich stattdessen auf alternative Quellen oder Verschwörungstheorien zu verlassen.
Laut tagesschau wägt der Verfassungsschutz ab, ob die AfD als "gesichert rechtsextrem" eingestuft werden soll.
Mehr dazu in diesem Artikel.
Bild: KI
Text: Blog-Team
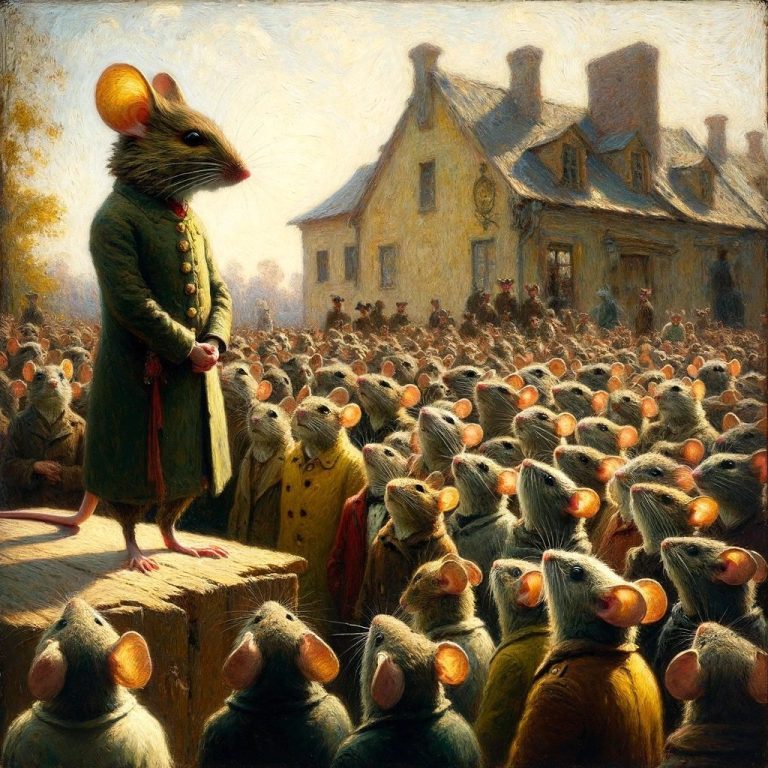
Europapa
Joost Klein - Europapa | Netherlands 🇳🇱 | Official Music Video | Eurovision 2024
12.03.2024
Der Songtext von Europapa thematisiert die Idee von Einheit und Zusammenhalt in Europa, unterstreicht aber auch die persönlichen Herausforderungen und das Gefühl der Isolation, das Menschen trotz der Möglichkeit, sich frei zu bewegen, erleben können. Der Refrain "Welkom in Europa / Blijf hier tot ik doodga" (Willkommen in Europa / Bleib hier bis ich sterbe) kann als eine Einladung oder sogar eine Hymne für die europäische Idee der Offenheit und des Zusammenlebens verschiedener Kulturen gesehen werden.
Die Strophen zeichnen ein Bild von Reiselust und der Suche nach Zugehörigkeit und Identität innerhalb Europas.
Die Erinnerung an die Worte des Vaters "Het is een wereld zonder grenzen" (Es ist eine Welt ohne Grenzen) verstärkt die Idee, dass trotz aller Hindernisse und Unterschiede die Vision eines vereinten Europas und einer grenzenlosen Welt lebendig bleibt.
Text: Blog-Team
Link zum Kommentar im taz-Blog
https://blogs.taz.de/zylinderkopf/now-or-never-eu-am-scheideweg/
Hitler und die Frauen
08.03.2024
Am 09.04.1933 erschien der Artikel "Hitler und die Frauen" in der österreichischen "Arbeiter-Zeitung". Heute, am Weltfrauentag 2024, kann man mahnend daran erinnern.
Was könnten heute politische Strömungen bewirken, die zu einem traditionellen Frauenbild zurück möchte? Wahrscheinlich hätten sie es deutich schwerer. Der Blick zurück wirkt wie ein Mahnmal.
Hier ist eine Zusammenfassung des verlinkten Original-Artikels:
Ellen Wilkinson, eine bekannte sozialistische Publizistin und ehemalige Abgeordnete der englischen Arbeiterpartei, kritisiert in ihrem Artikel das Frauenbild der Nationalsozialisten während ihres Deutschlandbesuchs. Wilkinson hebt hervor, dass der Aufstieg der Nationalsozialisten teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Hitler offen ausspricht, was viele denken, aber nicht zu sagen wagen, insbesondere in Bezug auf Frauen in "männlichen" Berufen.
Die Autorin betont die ungünstige Stellung von Frauen in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg und wie sich deren Rolle durch den Krieg, die Revolution von 1918 und die Weimarer Verfassung veränderte, wodurch sie Wahlrecht und Gleichberechtigung erhielten. Trotz des gestiegenen Ansehens und Einflusses der Frauen in der Weimarer Republik kritisiert Wilkinson die Nationalsozialisten für ihre rückwärtsgewandte Einstellung zu Frauen, die sich auf traditionelle Rollen beschränken sollen. Sie nennt Beispiele von erfolgreichen Frauen der Republik und erklärt, wie diese von den Nationalsozialisten verdrängt wurden.
Wilkinson verurteilt die "Säuberungsaktionen" der Nationalsozialisten, bei denen Frauen aus öffentlichen Ämtern entfernt wurden, und kritisiert die wirtschaftliche Grundlage der Nazi-Bewegung als eine Art Stellenvermittlung, die Männer bevorzugt. Sie erwähnt, dass Hitler eine weibliche Anhängerschaft hat, die jedoch traditionellen Rollenbildern folgt und unabhängige berufstätige Frauen ablehnt.
Abschließend drückt Wilkinson ihre Hoffnung auf die jungen, unabhängigen Frauen in Deutschland aus und betont, dass ihre Freiheit und Unabhängigkeit von den Nationalsozialisten bedroht ist, diese aber letztlich die Zukunft gehören.

Demo-Planung
07.03.2024
Die Planung einer Demonstration und der anschließenden Kundgebung ist nicht immer einfach. Trotzdem hat das breite Bündnis aus Initiativen und demokratischen Parteien auch eine Menge Spaß bei den regelmäßigen gemeinsamen Planungstreffen.
Fotos: KS, Text: Blog-Team
Auswirkungen auf die Klimapolitik, wenn Trump die US-Wahl gewinnt
07.03.24
Demokratie führt auch manchmal auch zu seltsamen Entscheidungen, das zeigen Prognosen zur US-Wahl.
Fangen wir aber mit einem Rückblick an:
Das Pariser Abkommen zielt darauf ab, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Die US-Wahlen könnten deutliche Folgen haben, was die Verfolgung der Klimaziele in den USA betrifft: Wenn Trump eine zweite Amtszeit antritt und die USA ihr Ziel einer Reduzierung der Emissionen um 50-52% bis 2030 verfehlen. Ein Weiter wie bisher würde aber fatale Auswirkungen haben: Beispielsweise könnte es den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen, extreme Wetterereignisse noch häufiger machen und die Biodiversität gefährden, was die globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels untergräbt.
Die Analyse von Carbon Brief zeigt, dass Bidens Klimapolitik, einschließlich des Inflation Reduction Acts, signifikante positivere Auswirkungen auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen hat. Trumps Absicht, Bidens Maßnahmen rückgängig zu machen, könnte die Fortschritte gefährden und die USA von ihren Klimazielen abbringen.
Beide Präsidenten werden voraussichtlich die vereinbarten Klimaziele nicht erreichen, aber der Unterschied der Verfehlung ist deutlich (siehe Link).
Darum:
Auch wenn du nicht in den USA wählen kannst, eine demokratische Wahl kann so viel ausrichten. Die einfachen Antworten sind nicht immer die besten - man sollte sie eigentlich immer hinterfragen. Wähle klug!
Bild: KI
Text: Blog-Team

US-Präsident dreht den Ölhahn auf
AfD und TikTok
05.03.24
Was die AfD zur erfolgreichsten Partei auf TikTok macht
Die AfD hat sich auf TikTok als sehr erfolgreich erwiesen, indem sie junge Wählerinnen und Wähler durch häufiges Posten und zuspitzende Botschaften anspricht. Der Algorithmus von TikTok begünstigt dabei ihre radikalen Positionen und polarisierende Inhalte, was ihnen hilft, eine deutlich größere Reichweite zu erzielen als andere Parteien. Politikberater und Medienpsychologen weisen darauf hin, dass die AfD ihre Inhalte effektiv aufbereitet und andere Parteien im digitalen Raum hinter sich lässt.
Und hier der Hinweis auf eine mögliche Gegenmaßnahme, falls ihr ein TikTok-Account habt, hier ist ein Link zu TwitterX mit einem Tipp zur Gegenmaßnahme.
https://x.com/NimaOgR/status/1764773963324924406?s=20
Text: Blog-Team
Bild: KI

Brühl im Klimawandel: Ein Kampf zwischen Ignoranz und Notwendigkeit
04.03.2024
In einer Zeit, in der der Klimawandel unsere Lebensweise und unsere Zukunft bedroht, stehen wir in Brühl, wie auch anderswo, vor der Herausforderung, zwischen widerstreitenden politischen Ansätzen zu navigieren. Auf der einen Seite steht die AfD, die den menschlichen Einfluss auf das Klima infrage stellt und Klimaschutzmaßnahmen als politische Kampfbegriffe abtut. Auf der anderen Seite steht das dringende Bedürfnis unserer Stadt, auf die realen und spürbaren Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren.
Die Stadt Brühl hat kürzlich ihr "Klimafolgenanpassungskonzept" vorgestellt, das den dringenden Handlungsbedarf aufzeigt. Mit einer durchschnittlichen Temperaturerhöhung von 1,1 °C im Vergleich zu den 1950er Jahren und einer Zunahme extremer Hitzeereignisse ist klar, dass der Klimawandel kein fernes Szenario mehr ist, sondern eine gegenwärtige Realität, die uns alle betrifft.
Die AfD hingegen bestreitet die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen und lehnt Projekte zur Dekarbonisierung sowie den "Klimaschutzplan 2050" der Bundesregierung ab. Diese Haltung steht im direkten Gegensatz zu dem, was unsere Stadt und die Welt jetzt brauchen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich einig, dass der menschliche Einfluss auf das Klima real und signifikant ist. Die von der AfD zitierten "umstrittenen" wissenschaftlichen Aussagen stehen isoliert gegenüber dem Konsens führender Klimawissenschaftler weltweit.
Die Haltung der AfD mag für einige attraktiv erscheinen, da sie einfache Antworten auf komplexe Fragen bietet und die Verantwortung von uns wegnimmt. Aber die Realität des Klimawandels wird durch Leugnung nicht weniger bedrohlich. Es ist Zeit, dass wir in Brühl und darüber hinaus erkennen, dass Klimaschutz nicht nur eine politische Frage ist, sondern eine Frage des Überlebens.
Wir müssen gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft arbeiten, in der Klimaschutz an erster Stelle steht. Die Verantwortung liegt bei uns allen, von der individuellen Ebene bis hin zur kommunalen und nationalen Ebene. Die Stadt Brühl hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber es ist wichtig, dass wir alle diesen Weg unterstützen und weiterverfolgen.
Text: Blog-Team
Bild: KI

1.442 Demos mit 4,4 Millionen Menschen
04.03.2024
In Zeiten, in denen die Grundfesten unserer Demokratie herausgefordert werden, hat unsere Gemeinde einmal mehr ihre tiefe Verbundenheit mit den Werten der Freiheit, Vielfalt und Solidarität unter Beweis gestellt. Am 26. Januar 2024 versammelten sich etwa 5.000 Menschen aus Brühl, um ein deutliches Zeichen gegen rechte Kräfte zu setzen, die unsere demokratischen Strukturen untergraben wollen.
Dieses Ereignis in Brühl ist Teil einer landesweiten Bewegung, die sich für die Stärkung unserer Demokratie einsetzt, die bis heute anhält. Laut einem Beitrag auf bluesky, wurden seit Mitte Januar bundesweit 1.442 Demonstrationen mit fast 4,4 Millionen Teilnehmenden gezählt, ein beeindruckendes Zeugnis der demokratischen Vitalität in unserem Land.
Die Demonstrationen zeigen nicht nur die Stärke unserer Gemeinschaft, sondern auch die Entschlossenheit, unsere Demokratie gegen jegliche Form von Extremismus zu verteidigen. Unter den Leitmotiven #niewiederistjetzt, #demokratie, #demokratieleben und #grundrechte wird nicht nur ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt, sondern auch unsere tiefgreifende Verbundenheit mit den Grundwerten unserer Gesellschaft zum Ausdruck gebracht.
Text: Blog-Team
Bild: Blog-Team
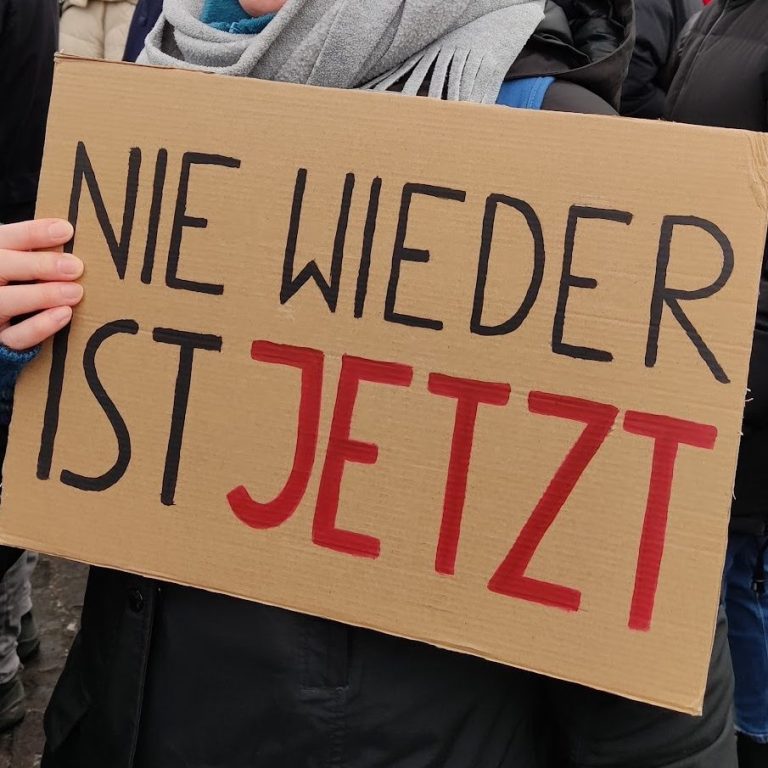

Nie wieder: März 1936
März 1936 - Der Einmarsch ins Rheinland
Am 7. März 1936 marschierten 30.000 Wehrmachtsoldaten über die Hohenzollernbrücke nach Köln und in andere Teile des Rheinlands, ein Gebiet, das gemäß dem Versailler Vertrag und dem Locarno-Pakt entmilitarisiert sein sollte. Dieser Akt war nicht nur ein Verstoß gegen diese Verträge, sondern auch ein entscheidender Moment, der Hitlers Macht im Deutschen Reich festigte und den Weg für weitere aggressive Expansionspolitik ebnete.
Günther Roos, damals Schüler in Brühl, erinnert sich an diesen historischen Tag aus einer sehr persönlichen Perspektive. In seiner Jugend war die Bedeutung des Moments nicht sofort klar. Für ihn war das unerwartete Schulfrei nach der "langweiligen Führerrede" zunächst ein Grund zur Freude.
Im Rückblick war es ein Meilenstein auf dem Weg zum Untergang.
Hitlers Risikobereitschaft wurde belohnt, da weder Frankreich noch Großbritannien militärisch reagierten, was hauptsächlich auf ihre internen Differenzen und die fehlende Unterstützung untereinander zurückzuführen war. Hitlers Vorgehen stärkte seinen Ruf als Führer, der Deutschland wieder zu alter Stärke führen konnte, ohne unmittelbare Konsequenzen fürchten zu müssen.
Die Ereignisse von 1936 sind ein mahnendes Beispiel dafür, wie die Duldung von Vertragsbrüchen und Aggressionen zu einer weiteren Ermächtigung autoritärer Führer führen kann. Die Lehren aus dieser Zeit sind heute relevanter denn je, insbesondere in einer Ära, in der demokratische Werte und die internationale Ordnung erneut unter Druck stehen.
Tagebuch Günther Roos
Lebendiges Museum Online Der Einmarsch ins Rheinland 1936
Bild: KI
Text: Blog-Team
Tausende Teilnehmer bei Demo gegen Rechtsextremismus in Brühl
27.01.24
In Brühl fand eine beeindruckende Demonstration gegen Rechtsextremismus statt, die von dem Bündnis "Gemeinsam für Brühl" initiiert wurde. Tausende Menschen, darunter auch Familien mit Kindern, kamen zusammen, um ein starkes Zeichen für Demokratie und gegen Hass zu setzen. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme der jüngeren Generation, die mit selbstgemachten Plakaten ihre Botschaften für Toleranz und Vielfalt zum Ausdruck brachten. Die hohe Beteiligung und die emotionale Atmosphäre unterstreichen die Wichtigkeit des Themas und den Wunsch der Gemeinschaft, aktiv für ein buntes und offenes Deutschland einzustehen.
Text: Blog-Team

Protestwelle
03.03.2024
Was ihr über die Demos gegen Rechtsextremismus wissen solltet 📢
In dem Video "Was ihr über die Demos gegen Rechtsextremismus wissen solltet" nimmt der ZDFheute-Faktenchecker Nils Metzger einige dieser Desinformationen unter die Lupe. Durch die Analyse von drei konkreten Beispielen deckt er auf, wie Falschinformationen über die Demonstrationen verbreitet werden und widerlegt diese effektiv.
Zusätzlich führt ZDF-Reporterin Alexandra Hawlin Gespräche mit dem Extremismusforscher Jakob Guhl und dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Sie erörtern, wer von der Verbreitung von Desinformationen profitiert und welche Auswirkungen die Demos tatsächlich haben können. Diese Diskussionen bieten tiefe Einblicke in die Mechanismen hinter den Kulissen der politischen Auseinandersetzungen und beleuchten die Bedeutung der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Extremismus.
Die Demos gegen Rechtsextremismus sind nicht nur ein Zeichen des Widerstands, sondern auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Stimmung in Deutschland. Sie zeigen, dass viele Bürger bereit sind, für die Werte der Demokratie und Vielfalt einzustehen. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig es ist, informiert zu bleiben und sich nicht von Falschinformationen leiten zu lassen.
Text: Blog-Team
© Gemeinsam für Brühl 2022-2024 | Impressum | Datenschutzerklärung
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.